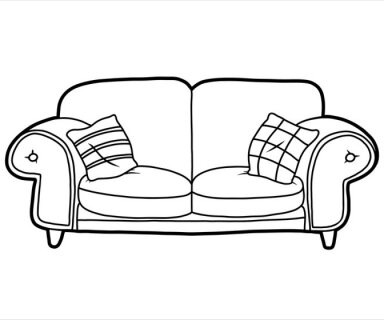Tagebuch meiner Lektüren
März 2009
Drei Bücher von WAGENBACH, die eine Weile unausgepackt, unangesehen, ungehuldigt, bei der Post lagen, ehe ich sie heute, am 2. März, nach ein paar Tagen der Abwesenheit und des Nicht-wann-die-Post-offen-hat-da-sein-Könnens endlich abholen und aus der viel zu großen Verpackung, in der sie beim Transport nur so hin und her geflogen sein müssen, befreien konnte: NATALIA GINZBURG: ANTON ČECHOV – EIN LEBEN (aus dem Italienischen von Maja Pflug, Wagenbach Tb. 2009). ČECHOV könnte einem jederzeit in der S-Bahn gegenübersitzen. Er hat diese zeitgemäße, ironisch-schwermütige Lässigkeit und den prüfenden, ernsten Blick, der ihn sofort interessant und gegenwärtig macht. Er ist wirklich da. Das Foto von 1894, in Jalta aufgenommen, so wie er da sitzt, möchte man gleich mit ihm reden, über alles Mögliche, Literatur, die Kranken, Politik, den Bau eines Badehäuschens unten am See. Aber wie wäre es, wenn er einem beim Frühstück gegenübersäße? Hielte man das aus? Wäre man nicht bedrückt, weil man denkt, man kann dem nicht genügen? Dieser musternd-distanzierte Blick, der Mund, der sich zu einem spöttischen Lächeln verzieht, die Einsamkeit, die diesen Menschen umgibt und die man nie durchdringt? Wer möchte man sein? Vielleicht ein Freund, der zu Besuch kommt ... wieder abfährt ... Briefe schreibt und erhält ... Einer von denen, die neben ČECHOV auf dem Sofa sitzen, im März 1892, in seinem Arbeitszimmer in Melichowo ... Wie traurig würde er einen machen, würde man ihn mehr als freundschaftlich lieben. – Im Klappentext steht: »Mit ihrer [GINZBURGs] großen Kenntnis innerfamiliärer Konstellationen ...« – hat diese Kenntnis nicht jeder? GINZBURG auch wieder ein Juli-Kind (14.), wie PROUST (10.) Das Buch wirkt wie eine Skizze zu der eigentlich zu schreibenden Biographie, so lakonisch, so knapp, dazu im Vergleich die PROUST- oder die KAFKA-Biographie, überpsychologisierend, geschwätzig, spekulierend. Sehr schön kommt das Gesellige, das Familienleben heraus, diese Wärmestube, die manchmal das Paradies und so oft die Hölle ist. Der nüchterne Ton, den GINZBURG in ihren Sachen perfektioniert hat, herrscht auch hier, und natürlich denkt man sogleich an diese Stelle in FAMILIENLEXIKON, wo sie erzählt, wie ihre Mutter immer an allen Büchern herumkritisiert hat, weil sie kein »Geschlabber« mochte. Und so schreibt GINZBURG, um ihrer Mutter zu gefallen, ihr Leben lang immer nur kurze Sachen, es gibt kein dickes Buch von ihr, auch die Romane sind im Grunde nur etwas längere Erzählungen. Das ist wie bei ČECHOV, auch er mochte kein Geschlabber, auch er schrieb keinen Roman, strich in seinen Erzählungen alles raus, was überflüssig war, wurde trockener und trockener. Und natürlich hat GINZBURG das geliebt.
Er gab niemandem recht oder unrecht. So war Čechov in seinen frühen Erzählungen, und so war er auch in seinen letzten. Ein Schriftsteller, der niemals kommentierte.
Aber muss man ihr Büchlein zu Ende lesen, jetzt, wo man nach der Hälfte weiß, wie sie’s macht? Eigentlich nicht. ––– Nach seinem ersten schweren Tuberkulose-Anfall fährt ČECHOV nach Paris und dann weiter an die französische Riviera, liest da Zeitungen, die voll sind mit Kommentaren zur DREYFUS-Affäre, bewundert ZOLA für seinen offenen Brief. Auch die Mittel- und Westeuropäer lasen die Russen (TOLSTOI, DOSTOJEWSKIJ, LERMONTOW, PUSCHKIN), aber wer ist schon hingefahren und hat sich dort umgesehen? Nur deutsche Ärzte und Beamte. Russland lag jenseits der eurozentristisch eingehegten Weltgeschichte – wie FÖLDÉNYI in dem lila Bändchen anhand von DOSTOJEKWSKIJs HEGEL-Lektüre und seines Entsetzens, dass sein Leid nichts zählen soll, beschreibt. ––– In Triest war ČECHOV auch, im September 1894, da war er 34 Jahre alt. Aber anscheinend hat er nichts über die Stadt geschrieben, nichts Kanonisches jedenfalls, denn es findet sich kein Text von ihm in dem gerade bei WAGENBACH herausgekommenen Band TRIEST – EINE LITERARISCHE EINLADUNG (herausgegeben von GABY WURSTER). Dafür natürlich SVEVO und JOYCE und MAGRIS, dem Autor des inzwischen berühmten Bandes TRIEST – EINE LITERARISCHE HAUPTSTADT IN MITTELEUROPA (aus dem Italienischen von Ragni Maria Gschwend, dtv 1993). ERNST H. GOMBRICHs SCHATTEN – IHRE DARSTELLUNG IN DER ABENDLÄNDISCHEN KUNST (aus dem Englischen von Robin Cackett (Wagenbach 2009) ist ein sehr zügiges Buch, GOMBRICH hält sich nirgendwo lange auf, es ist wie ein eiliger Rundgang durch eine nicht unbedeutende Gemäldegalerie – sehen Sie hier: LEONARDO, der sich gegen die Malerei des Quattrocento wendet, beachten Sie dort: CARAVAGGIO, der die Kontraste liebt, das chiaroscuro, das Schlagschatten vermeidet, das tenebroso, das mit der Tabuisierung harter Schatten bricht – ein Parforceritt quer durch die Geschichte der Schattenmalerei von der Antike bis DE CHIRICO. Und man lernt wieder einmal, wie sehr das Sehen dem Geschmack unterworfen ist. Dass der Maler nicht malt, was er sieht, sondern was er sehen will. ––– Nun kommen sie wieder, die Bücher. Heute, am 3. März, ein wunderwunderschön aussehendes von Wallstein, DANIELA DANZ’ Gedichtband PONTUS. Obwohl es in seinem Eingeschweißtsein perfekt war (wie manche Süßigkeiten oder Feinschmeckereien, die man auch nicht aufmachen möchte, weil der Inhalt hinter der Verpackung nur zurückbleiben kann), machte ich die Folie eben ab – und, leider, es stinkt, und der Glanz ist fort, und die glatte Makellosigkeit wird nun durch die vom Buchblock wegklaffenden Umschlagklappen gestört. Nie wieder wird es so lockend-verlockend sein. Dafür kann man jetzt aber ins Buch sehen und das Autorinnenfoto anschauen, und zuerst und allein dafür lohnt es sich schon, große, lebendige Augen sehen einen da an, und dann sind da Sommersprossen und ein weicher Mund, den man, ja das gebe ich zu, gern diese Gedichte sprechen hören würde, vor allem aber die zwischen die Kapitel gesetzten Prosatexte, die kleine, elliptische, mythen- und geschichtsverdichtende Erzählungen sind, da gibt es schon eine Anziehung. Aber der Funke, der überspringende, bleibt aus. Muss er von der Dichterin kommen oder vom Leser – oder von beiden, ein Ladungsausgleich der Gehirne, Seelen? Dazu aber braucht es Spannung. Und die baut sich, trotz allen Könnens, nicht auf. ––– Und am Nachmittag des 4. März kamen gleich vier Bücher von Hanser in einem großen Karton, in weiches Papier gebettet. Bei dem Dichter BEI DAO (= Insel im Norden) erfahre ich, dass es in der chinesischen Dichtung den Titel wuti (ohne besonderes Thema) gibt: In seinem BUCH DER NIEDERLAGE (Edition Lyrik Kabinett 2009), einer Zusammenstellung von zwei Gedichtsammlungen und einigen Gedichtmanuskripten, übersetzt von Wolfgang Kubin, kommen mehr als zehn solcher Gedichte vor, darunter dieses:
OHNE BESONDERES THEMA
Für Martin Mooij
Briefmarkensammler blicken klamm auf das Leben
Eine kurze Freude
Die Nacht kniet anmaßend nieder
Sie hält hoch das Lampenlicht von Generationen
Der Wind wendet sich, die Vögel werden irre
Ihr Gesang schüttelt so viele Äpfel herunter
Wachen Liebhabern ist das Haar ergraut
Ich bücke mich in Betrachtung meines Geschicks
Quellwasser tröstet mich
in diesem nutzlosen Moment
Auch wenn da ein paar Dinge kritisch anzumerken sind – wäre Vers vier ohne das »anmaßend« nicht besser?, und haben Vögel, die »irr« werden, einen »Gesang«, der Äpfel vom Baum zu schütteln vermag?, ist es nicht eher ein Gekrächze oder Geschimpfe oder Tschilpen oder Schreien? –, so bekommt der Tag beim Lesen dieser Zeilen doch einen anderen Rhythmus, verlangsamt sich und wird meditativ, und vielleicht ist das der Grund, weshalb wir Lyrik lesen, dass sie einen innehalten, im Augenblick ruhen lässt. Und natürlich passt dazu sehr gut PHILIPPE JACCOTTET mit seinen NOTIZEN AUS DER TIEFE (Deutsch von Friedhelm Kemp, Elisabeth Edl und Wolfgang Matz, Edition Akzente, Hanser 2009), meinem ersten eigenen JACCOTTET, seit ein HANDKE-Interview mich auf ihn aufmerksam machte und ich dann in einer Buchhandlung ein paar Bände durchging. Doch dann und vor allem: DAVID RIEFF: TOD EINER UNTRÖSTLICHEN. DIE LETZTEN TAGE VON SUSAN SONTAG (aus dem Englischen von Reinhard Kaiser, Hanser 2009):
Schon zu Beginn ihrer Krankheit schrieb sie, auch wenn sie sie intellektuell ablehne, akzeptiere sie gefühlsmäßig doch die alte These des Psychologen Wilhelm Reich – jene These, die Norman Mailer, nachdem er seine Frau mit einem Messer attackiert hatte, prahlen ließ: »Auf diese Weise habe ich mir eine Menge Krebs vom Hals geschafft« –, dass nämlich der Krebs im wesentlichen ein Ergebnis der Unterdrückung von Sexualität sei. »Ich habe das Gefühl, mein Körper hat mich im Stich gelassen«, schrieb meine Mutter. »Und mein Verstand ebenfalls. Denn irgendwie glaube ich an die Behauptung von Reich. Ich bin für meinen Krebs selbst verantwortlich. Ich habe wie ein Feigling gelebt und mein Verlangen, meine Wut unterdrückt.«
Erst schien mir das Buch oberflächlich, weinerlich, redundant, aber dann entfaltete es eine ungeheure Wirkung. Die Redundanz ist die Redundanz der Trauer, des Schuldgefühls, der Angst. Der Angst, die in uns allen steckt, vor dem Sterben und dem Tod, dem eigenen und dem der von uns Geliebten, eine Angst, die wir nicht wahrhaben wollen, in uns verstecken, und die doch ständig da ist, jetzt, wenn wir dieses Buch lesen, und mehr noch, wenn wir es zuschlagen und uns wieder unserem Leben widmen, dem außerhalb des Lesens, das ja immer eines des Gelesenen ist, das nachwirkt und plötzlich auftaucht und uns überrascht, mit der Angst, die wir doch so gut versteckt, verdrängt glaubten.
Doch seit ihrer erneuten Erkrankung war ihr auch das kürzeste Alleinsein unerträglich, und bald organisierten diejenigen, die ihr nahe waren, eine Art Bereitschaftsdienst und sorgten dafür, dass immer zumindest einer von ihnen bei ihr war und nach Möglichkeit mehrere. John Berger, der englische Schriftsteller, hat einmal geschrieben, nicht Hass sei das Gegenteil von Liebe, sondern »sich trennen«.
Wie viel Anmaßung aber auch darin steckt. Die anderen haben da zu sein, ihr beizustehen, weil sie nicht allein sein kann. Woher weiß sie das? Versucht sie, sich der Einsamkeit auszusetzen? Was macht das mit ihr? Was heißt unerträglich? Und was macht ihre Erwartungshaltung mit den anderen? Mit ihrem Sohn? ––– 11. März: JOSÉ ORTEGA Y GASSET: ÄSTHETIK IN DER STRASSENBAHN. ESSAYS. HERAUSGEGEBEN UND MIT EINEM NACHWORT VERSEHEN VON KARLHEINZ BARCK UND STEFFEN DIETZSCH. AUS DEM SPANISCHEN VON KARL AUGUST HORST, ULRICH KUNZMANN, ULRICH WEBER, HELENE WEYL. VOLK & WELT 1987, SPEKTRUM 224. ––– 12. März: SARA SHILO: ZWERGE KOMMEN HIER KEINE. ROMAN. AUS DEM HEBRÄISCHEN UND MIT EINEM NACHWORT VON ANNE BIRKENHAUER. dtv 2009 und STEFAN MÜHLDORFER: TAGSÜBER DIESES STRAHLENDE BLAU. ROMAN. dtv 2009. ––– Und endlich und in zwei Nächten JONATHAN SAFRAN FOER: EXTREM LAUT UND UNGLAUBLICH NAH (Roman, S. Fischer Tb. 2007). Dieses Buch zu lesen hatte ich schon eine Weile vor, insbesondere aber, seit ich am 24. Februar die Dokumentation über/mit New Yorker Schriftstellern sah, darunter FOER. Las in der Nacht vom 17. auf den 18. März nun auf einen Zug ca. 230 Seiten. Und weiß nicht, ob mir das Buch gefällt. Es ist ein Einmal-Buch. Man liest es schnell. Macht FOER es sich nicht zu einfach? Dieses hyperintellektuelle Kind. (Wie bei TERÉZIA MORA – merkwürdig, diese Parallelen. Natürlich ist es legitim, so jemanden zu etablieren, auch als Erzähler, aber es wirkt aufgesetzt, setzt zu sehr auf Eindruckschinderei.) Die schnelle Lektüre (page-turner) kann Kopfschmerzen/Übelkeit verursachen. Überdruss. Wenn man dann doch – notgedrungen, da völlig erschöpft und schon heiß vor Müdigkeit – unterbricht, hat man am Tag darauf keine Lust, weiter-, zu Ende zu lesen. Höchstens, um es weg zu haben, ein für allemal. Dagegen die Bücher, die lange, lange auf dem Schreibtisch liegen und die einen lächeln lassen, wenn der Blick sie streift, die Vorfreude aufs Lesen, Weiterlesen. Es ist letztlich ein Buch, das einen, bei aller Gefühligkeit, nicht berührt. Dieser Großvater: Noch nie hat jemand, der nicht spricht, so viel gesprochen. Man wird geradezu erdrückt von so viel Worten. – Und warum lässt die Großmutter am Ende den Enkel, Oskar, im Stich? Weshalb sollte ihr der Mann wichtiger sein? Weil es so hübsch ist, dass die beiden nun am Flughafen leben? – Bedeutungsschwangere Sätze geben einem das Gefühl, ein bedeutender Dichter zu sein. Ein intellektualistisches Buch. Nicht aus Notwendigkeit geschrieben, sondern aus Geltungssucht. – Dass am Ende alles aufgeht – und man schon mindestens hundert Seiten vor Schluss weiß, dass sich alles fügen wird –, ach je, das macht keine Freude. Dieses Zu-Ende-Erzählen ist öde. Für den Leser und seine Imagination, seine Phantasie, bleibt so nichts mehr zu tun. ––– Am 19. März wieder mal großer Bucheinkauf, diesmal bei Wasmuth, der – zum Glück, muss ich sagen, denn wie viel wäre es sonst geworden? – wahnsinnig schlecht sortierten Buchhandlung im Filmmuseum/Arsenal (kein einziges Buch von/zu/über GODARD!). Die Lektüre von THOMAS ELSAESSERs und MALTE HAGENERs FILMTHEORIE – ZUR EINFÜHRUNG (Junius 2007) und dem von THOMAS KOEBNER und IRMBERT SCHENK herausgegebenen GOLDENEN ZEITALTER DES ITALIENISCHEN FILMS – DIE 1960ER JAHRE (Edition Text+Kritik 2008) (auf dem Umschlag – Szenenfoto aus FELLINIs 8 ½ – eine Olivetti) steht noch aus, aber am 25. März las ich den bei Artificium gekauften (s. o. bei Wasmuth kein GODARD) weiß-blauen Merve-Band (meinen ersten!) JEAN-LUC GODARD: LIEBE ARBEIT KINO. RETTE SICH WER KANN (DAS LEBEN) (aus dem Französischen übersetzt von Lothar Kurzawa und Volker Schäfer, 1981). Und da las ich also von der Auflösung der durch Gewöhnung als natürlich angesehenen Wahrnehmung/Ästhetik des Films; von der Kontrolle über die Bilder mithilfe der Sprache – GODARD traut der Poesie der Bilder nicht über den Weg, er fragt: Warum werden gerade die Wörter und Bilder benutzt, die benutzt werden? –, der Suche nach den »richtigen« Wörtern und Bildern, dem Verweilen bei Randereignissen als Zeichen dafür, wie schwer es heute sei, Gemeinsamkeit herzustellen (völliger Gegensatz zu WERTOW – eine Frage der Choreographie?, man legt Wert auf Unterscheidung, nicht auf Übereinstimmung). Von der Abneigung gegen gefühliges Einverständnis, Harmonie, die nur übers Gefühl läuft, nicht über den Geist. Von der Langeweile. ––– Und am 27. März dann, nachdem ich am Abend zuvor den Film geshen hatte, TRUMAN CAPOTE: FRÜHSTÜCK BEI TIFFANY – EIN KURZROMAN UND DREI ERZÄHLUNGEN (Rowohlt Tb. 2007). Erstaunlich, dass im Film der Mann/Erzähler von einer verheirateten Frau ausgehalten wird, im Buch aber nicht und also moralisch höher steht als Holly G., er auch keine Schreibkrise hat und also Erzählungen schreibt und auch veröffentlicht und, weil das – finanziell – nicht reicht, auch noch arbeiten geht – also Job und Schreiben und eine eigene schäbige Wohnung hat, nicht dieses Kitsch-Apartment von der reichen Liebhaberin. Erstaunlich, dass das für den Film so adaptiert wurde. Dafür ist das Ende im Buch viel besser – die beiden kommen nicht zusammen, es gibt kein bürgerliches oder Boheme-Glück. Aber: Das Buch beginnt mit einer Rückblende, und so ein Rahmen ist, weil man ihn irgendwann schließen muss, fast nie gut, wirkt immer konstruiert – um das zu vermeiden, müsste man es schon richtig übertreiben, Rahmen, Rahmen, Rahmen, lauter Rahmen öffnen und keinen schließen; dann säße der Leser da mit dem Webknäuel, die Fäden gingen in alle Richtungen – aber es ergäbe sich kein Teppich (aber ein Text wäre es natürlich trotzdem, und was für ein einer, s. GODARD?). ––– 19./20./23. März: MICHAEL TÖTEBERG: RAINER WERNER FASSBINDER (Rowohlt-Monographie, Rowohlt 2002). Ich las das Buch wegen der Romantrilogie ANGRIFFE von ALBAN LEFRANC – der erste Roman darin beschäftigt sich mit FASSBINDER, aber er geht so frei mit den Fakten um, dass man, um sich ein Urteil bilden zu können, über diese mehr wissen sollte. – 42 Filme in 37 Jahren. 42 Filme in 37 Jahren, das kehrt immer wieder als Gedanke. Eigentlich müsste man die ersten 20 Jahre abziehen – aber gut, Vorbereitung waren auch sie, wie alles, was man erlebt, Vorbereitung ist. Aber dann müsste man auch die neun Monate vor der Geburt und das Leben der Eltern und der Großeltern und immer sofort dazuzählen, und plötzlich stehen da die 13,7 Milliarden Jahre des Universums, und dann sind 42 Filme doch wieder nicht so viel (wenn auch mehr als bei den meisten anderen). Der Lebensabriss ist ziemlich trocken geschrieben, ist zu sehr Aufzählung der Fakten (Leben und Werk), zu wenig Analyse, zu wenig – von DOUGLAS SIRK abgesehen –, Einbeziehung der anderen gleichzeitig drehenden, nachdenkenden, schneidenden Filmregisseure (GODARD, TRUFFAUT, BERGMAN usf.), Theaterautoren, -regisseure (PEYMANN, ZADEK nur gestreift); fast komplette Aussparung des monströsen Beziehungsgeflechts – die privaten Volten erscheinen dadurch überraschend, übertrieben, unmotiviert (etwa, nur zum Beispiel, die Heirat mit und Scheidung von INGRID CAVEN). ––– 24. März (und immer wieder): JÜRGEN MÜLLER (HG.): FILME DER 60ER (Taschen o. J.). Immer vier Seiten pro Film, insgesamt 113 Filme. Und auch wenn der gesuchte, MASCULIN, FÉMININ – 15 FAITS PRÉCIS von GODARD, nicht dabei war, war das Zur-Hand-Nehmen des Bandes natürlich nicht umsonst. Ein paar Seiten nach GODARDs LE MÉPRIS folgt bereits DAS SCHWEIGEN von BERGMAN, und sofort will man alle BERGMAN-Filme wiedersehen. Und überhaupt alle Filme sehen. Besonders die der Sechziger. Die, glaube ich, mein Lieblingsfilmjahrzehnt sind. Allein die auf dem Rückumschlag nach Jahren aufgeführten Filmtitel zu lesen! Was für eine Verführung ins Dunkle, ins Kino. Und schon nur durch diese Liste begreift man viel (wenn man die Filme kennt) – was für eine große Zeit! ––– 31. März (und nie wieder): PETER SCHNEIDER: EDUARDS HEIMKEHR (Roman, Rowohlt Berlin 1999). Am Abend vier Kapitel (70 Seiten) – und schon genug. Gar nicht schlecht geschrieben – aber Literatur? Nur weil da jemand Sätze zu Papier bringen kann, muss man sie ja nicht lesen.
»Und was hat Pinka gemacht?« fragte Eduard. »Sie grüßt mich seitdem nicht mehr. Sie leidet sichtbar und standhaft an den neuen Stammgästen, die in ihrer Kneipe heimisch werden – Herren mit Aktenköfferchen, die sich über Skizzen von Immobilien und Ländereien beugen.«
Und da will ich sie mal nicht weiter stören bei ihrem sichtbaren und standhaften Leiden über Skizzen von Ländereien. Diese Bücher erinnern mich an den neuen neuen deutschen Film, Berliner Schule. Das sei unser Leben, wird da immer behauptet, aber wenn es so langweilig und öde ist (meins sieht anders aus), muss ich es dann auch noch mal lesen? Begreift doch mal, was Sprache kann – immer nur Beschreibung, Beschreibung, und ab und an ein müder Witz (garantierter Lacher bei Lesungen). Stellt euch die Leser mit glühendem Kopf und offenen Mündern vor! Aufspringend und in der Wohnung auf- und ablaufend! Vor Glück leuchtend! Oder still lächelnd, nach innen, nach innen.
RESTE: 6. März: KURT VONNEGUT: DER TAUBENBLAUE DRACHE. SCHÖNE GESCHICHTEN. ÜBERSETZT VON HARRY ROWOHLT. KEIN & ABER 2009. ––– 10. März: MIRCEA CARTARESCU: NOSTALGIA. AUS DEM RUMÄNISCHEN VON GERHARDT CSEJKA. SUHRKAMP 2009. Überarbeitung der Übersetzung, die 1997 bei Volk & Welt erschienen ist. Der »Spiegel« nannte ihn einen »Proust des Plattenbaus« – ob das geht, Proust im Plattenbau? ––– 12. März: TANJA MALJARTSCHUK: NEUNPROZENTIGER HAUSHALTSESSIG. AUS DEM UKRAINISCHEN VON CLAUDIA DATHE. RESIDENZ VERLAG 2009. Habe sie bei der Wechselstrom-Veranstaltung in der Volksbühne live erlebt. ––– MATTHIAS FRINGS: DER LETZTE KOMMUNIST. DAS TRAUMHAFTE LEBEN DES RONALD M. SCHERNIKAU. AUFBAU 2009. Dieses abgewrackte, rotzhässliche, dreckige, korruptionsspekulationsversumpfte West-Berlin der Achtziger. Diese Klamotten, die man damals trug – es ist leicht, darüber die Nase zu rümpfen. ––– VLADIMIR ZAREV: FAMILIENBRAND. ROMAN. AUS DEM BULGARISCHEN VON THOMAS FRAHM. DEUTICKE 2009. ––– 27. März: OSTEUROPA. In einer phantastischen Verpackung – man öffnet sie mit einem Streifen, den man rundum abzieht, in der Mitte, hat dann zwei Kartonhälften, die man vom Buch abstreift:
//FOTO//
Die Zeitschrift macht einen sehr guten Eindruck. ––– 28. März: FASSBINDER ÜBER FASSBINDER. DIE UNGEKÜRZTEN INTERVIEWS. HG. V. ROBERT FISCHER. VERLAG DER AUTOREN 2004. ––– KLASSIK UND AVANTGARDE. DAS BAUHAUS IN WEIMAR 1919–1925. JAHRBUCH DER KLASSIK STIFTUNG WEIMAR 2009. HERAUSGEGEBEN VON HELLMUT TH. SEEMANN UND THORSTEN VALK. WALLSTEIN 2009. ––– Für 1 Euro aus dem Antiquariat: JOSÉ ORTEGA Y GASSET: ÄSTHETIK IN DER STRASSENBAHN. ESSAYS. HERAUSGEGEBEN UND MIT EINEM NACHWORT VERSEHEN VON KARLHEINZ BARCK UND STEFFEN DIETZSCH. AUS DEM SPANISCHEN VON KARL AUGUST HORST, ULRICH KUNZMANN, ULRICH WEBER, HELENE WEYL. VOLK & WELT 1987, SPEKTRUM 224.