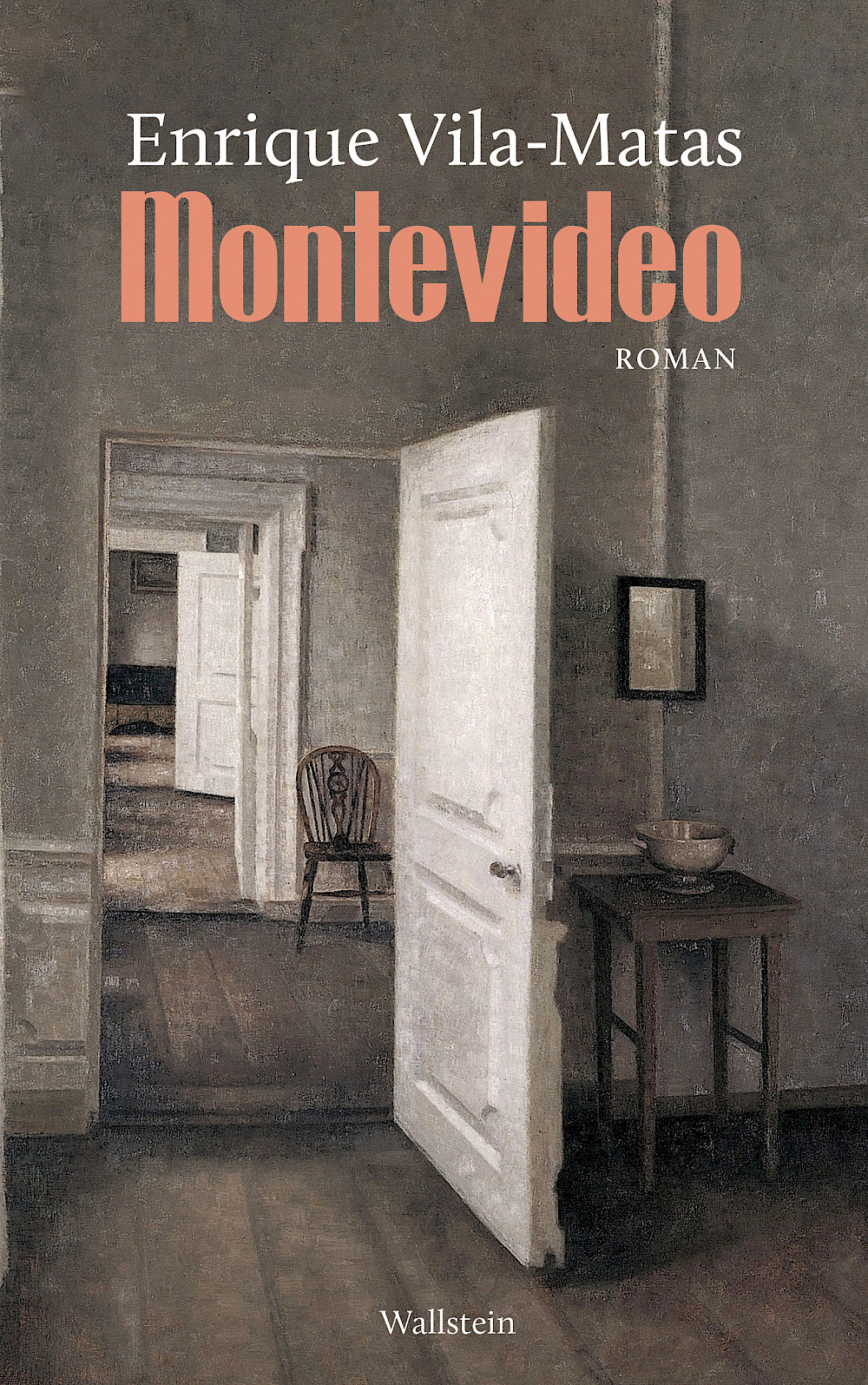Letzte Nacht – besser gesagt, um fünf Uhr morgens, mir fehlte nur noch ein Schal [à la Gide, Valéry] – stellte ich mir Spuren uralter Tiere vor, etwa von Insekten, im Schnee von Rom, Lichter und Lücken in Reykjavík und Spinnweben mitten in der Sonora-Wüste. Schließlich kam mir die »Erscheinung des Schriftstellers« in den Sinn, von der Roland Barthes sprach. Er sei ein Gespenst, sagte er uns, früher ein Vorbild für eine gewisse französische Jugend, das praktisch verschwand, als man in Frankreich nur noch selten einen Jugendlichen antraf, der beeindruckt war, wenn er einen Schriftsteller im Café sitzen sah und dachte, eines Tages wäre er gerne wie er.
Barthes erinnerte sich noch an viele Jugendliche seiner Generation, die, geblendet vom Schriftsteller als Phantasma, nicht von seinem Werk, danach strebten, eine solche Erscheinung zu werden, nicht etwa das Werk zu kopieren, sondern sein Verhalten im normalen Leben, diese Art, sich in der Welt zu bewegen, von der Barthes sprach, mit einem Notizbuch in der Tasche und einem Satz im Kopf, so wie er Gide durch Russland oder den Kongo hatte reisen sehen, beim Lesen der Klassiker, beim Schreiben an seinem Tagebuch, während er im Speisewagen auf sein Menü wartete, oder beim Lesen eines Buches eine Birne essend, so wie er ihn 1939 eines Tages in der Brasserie Lutetia erblickt hatte.
Für Barthes resultierte dieses schon sehr alte Phantasma »Schriftsteller sein zu wollen« aus einem bemerkenswerten Trugschluss, da er versuchte, uns die Figur des Autors eines literarischen Werks so zu präsentieren, wie man ihn in seinem persönlichen Tagebuch sehen kann, das heißt den Schriftsteller ohne sein Werk: die höchste Form des Sakralen: das Markenzeichen und die Leere.
Einerseits wäre da der Schriftsteller ohne Werk in jenen Zeiten, von denen Barthes sprach, ein Buch im Lutetia lesend, nur aus der Ferne beobachtet von manch einem Jugendlichen, sicherlich im Wunsch, dieselbe Birne zu essen, aber wohl ohne zu ahnen, dass er im Augenblick des Schreibens nichts weniger als schreiben müsste.
Ist es nicht zufällig genau das, was mir mit Mastroianni passiert ist, als ich ihn im Alter von fünfzehn Jahren in Die Nacht von Michelangelo Antonio in der Rolle des Schriftstellers Pontano sah? Alles deutet darauf hin, dass ich sein wollte wie er, besser gesagt, dass ich er sein wollte, ohne zu bedenken, dass ich dafür erst einmal schreiben musste und es nicht reichte, als Schriftsteller durchs Leben zu gehen. Einmal angesehen davon, dass ich damals noch nicht ahnte, wie sehr Schreiben voraussetzte, dass man nicht länger vorgab, ein Schriftsteller zu sein, und bei Gelegenheit komplett hinter dem eigenen Schreiben verschwand.
26
So hätten wir also auf der einen Seite Pontano mit einer Birne, aber ohne Werk, völlig blank, sogar ohne Messer für sein Obst, fast wie ein Schriftsteller-Phantom. Und auf der anderen ein paar »französische Schriftsteller«, nicht immer französisch, aber wahre Schriftsteller, stets bedacht auf »la discipline de l'esprit«, die grundsätzlich unbeständig und wechselhaft sind, aber ideal, um sich selbst als französischer Schriftsteller nirgendwo niederlassen zu müssen, nicht einmal in Paris.
Enrique Vila-Matas: Montevideo