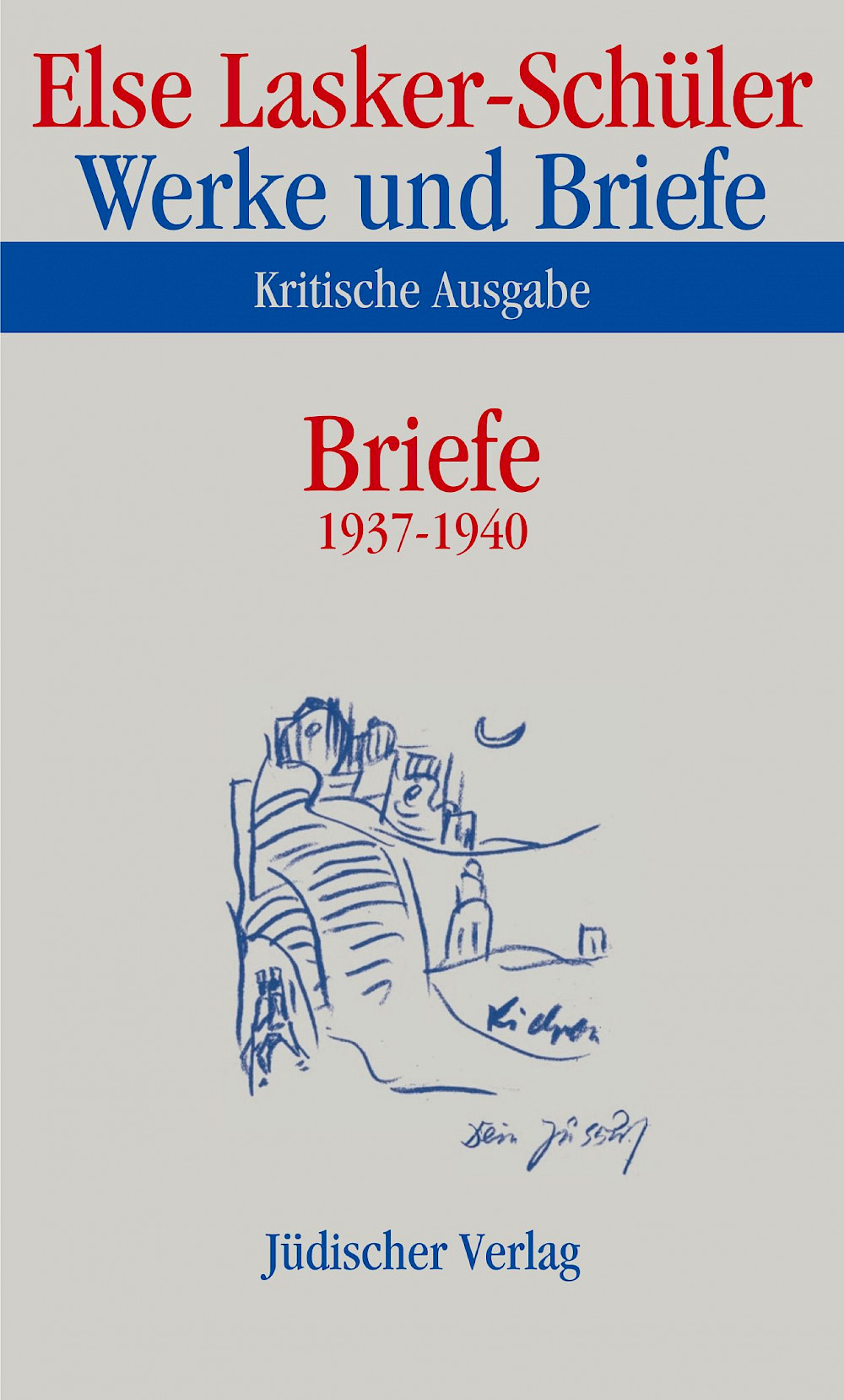Ich find nicht mehr, nie mehr zu mir zurück
Der Überlebenskampf des Blauen Jaguars: Else Lasker-Schülers Briefe von 1937–1940
Es gibt Menschen, die sind gezwungen, in ihrem Leben weite Wege zu gehen. Nicht nur haben sie geographisch große Entfernungen zurückzulegen, etwa von Elberfeld an der Wupper nach Berlin nach Zürich nach Jerusalem, nein, weit länger und abenteuerlicher ist die Wegstrecke, die sie innerlich gehen müssen, und wie oft verirren sie sich und wissen nicht ein noch aus in der Dunkelheit, der Wüsteneinsamkeit, vor der Trostlosigkeit des uferlosen Meeres, das sie durchschwimmen müssen, beständig in der Gefahr zu ertrinken.
Ich bin »abends oft so traurig«, schreibt Else Lasker-Schüler aus dem Zürcher Exil an den befreundeten Rechtsanwalt Emil Raas in Bern, den sie »Mill« und »Begleiter« nennt und der ihr »Fürsprech« ist, ihr hilft mit all den Dingen, die der Vermittlung bei den Behörden bedürfen: Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung, Einreise- und Ausreisebescheinigungen, Leumundszeugnisse. Er schickt ihr Geld und Honig – sie schreibt und zeichnet ihm Hunderte von Briefen, lässt ihn in ihr Herz schauen, das oft so schwer ist, wenn die Dämmerung heraufsteigt und ihr mythisches Dichtermärchenland bedroht, in das sie geflohen ist als »Jussuf, Prinz von Theben« im »bunten Kleid«, Träumer und Traumdeuter, und das sie gegen alle Schicksalsschläge verteidigt als »treuer Indianer«, als »Tino von Bagdad« und »blauer Jaguar«.
Ruhe in der Luft
Das Jahr 1937, das den Briefband eröffnet, beginnt gleich mit einem Verhängnis: Nachdem Else Lasker-Schülers Schauspiel „Arthur Aronymus und seine Väter« im Dezember 1936 uraufgeführt worden war und sie voll Freude ausgerufen hatte: »Was soll ich sagen (...) Unerhört war es gestern, unerhört! Es prangte die Bühne«, wurde das Stück bereits nach der zweiten Aufführung abgesetzt. Immer wieder versucht sie in den folgenden Monaten, eine Wiederaufnahme am Schauspielhaus zu erreichen, vergeblich – zu ihren Lebzeiten wird das Stück nie wieder gespielt. Auch finanziell gesehen ist die Absetzung ein schwerer Schlag, hatte sie doch schon fest mit den Einnahmen gerechnet. Nun muss sie wieder Bettelbriefe schreiben – »Dichter haben auch Hunger und leiden daran« – und hat Angst, ihre Aufenthaltsbewilligung, die von den Kantonalbehörden immer nur zwei-, dreimonatsweise verlängert wird, zu verlieren.
Wie zuvor ist sie von Mäzenen und Zahlungen der Israelitischen Cultusgemeinde abhängig, denn ohne den erhofften Status der »Duldung« ist ihr jede Art von Erwerbsarbeit untersagt. Trotz aller Ungewissheit arbeitet sie unermüdlich, zeichnet für ihr neues Buch, »Das Hebräerland«, das im März 1937 im Verlag Oprecht erscheint, koloriert die Luxusausgabe und beginnt mit den »Tagebuchzeilen aus Zürich«, in denen sie die Gewöhnung ans Emigrantendasein reflektiert.
Aber wie sich gewöhnen? Es ist ja fast immer Ausnahmezustand, kaum ein paar Wochen vergehen, ohne dass das Damoklesschwert Ausweisung sich bedrohlich über ihr senkt. Bereits im Februar war von der Fremdenpolizei ein Kontrolldetektiv zu »sachbezüglichen Erhebungen« ausgeschickt worden. Und auch wenn er keinerlei Verstoß feststellen konnte, in seinem Bericht sogar anführt, dass Lasker-Schüler monatlich zweihundert Franken Unterstützung erhalte, wird sie nicht verschont – Mitte Februar gibt die Kantonale Fremdenpolizei Zürich an die Städtische weiter: »Die deutsche Reichsangehörige Else Lasker-Schüler (...) hat die Schweiz am 31. März 1937 definitiv zu verlassen. Wir ersuchen Sie (...) eine Kontrolle zu veranlassen, ob dem Ausreisebefehl Folge geleistet worden ist.«
Wieder sind Briefe zu schreiben, ist bei den Behörden um Aufschub zu bitten, sind die Freunde und »Fürsprechs« in Bewegung zu setzen, ist auf die baldige Reise nach Palästina hinzuweisen. Und an Freund „Mill« schreibt sie: »Ich bin zu müde zu schlafen. Es ist schon Nacht – endlich Ruhe in der Luft und auf der Erde. Ich bin allein, ich bin wach. Ich bin betrübt, ich bin zu Ende (...) Ich find nicht mehr, nie mehr zu mir zurück. (...) Ich denke immer an Selbstmord nun die lange Zeit aber in der anderen Hand trage ich eine Rose. (...) Ich will nun doch schlafen, mein Herz klopft furchtbar. meine Gedanken ruhelos. Ich schäme mich. Ich will schon darum nach Jerusalem, mitkämpfen, mitmachen die Gefahren. Aber ich kann nicht mehr arm kommen, darum muß ich abwarten den April am Ende reisen. (...) Wenn es doch wenigstens warm wäre.«
Auch wenn es wieder ein paar Wochen länger dauert – wie immer gibt es Schwierigkeiten mit Finanzen und Visum und einer zu hinterlegenden Kaution –, Mitte Juni ist die Dichterin auf der »Galilea« und, mit geschenkter Überfahrt durch die italienisch-schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Lloyd Triestino, unterwegs nach Haifa: »Schon auf dem Lloyd, schon auf offener See. Schon Capitain gesprochen. Alle herrlich lieb zu mir. ... / Habe allein Kajütte I. Schäme mich wegen Touristenclasse / Um 9 Uhr: Cinema / Prinz Jussuf / Kapitain wundervoll / Gleich bring ich ihm mein Buch«.
Kahl an allen Ästen
Die Reise- und Ankunftseuphorie, das Anprobieren des neuen Lebens, der Luft, der Gerüche und Geräusche, die Besuche bei Freunden, das Belebende des Einzugs ins Hotel »Vienna, gleich neben dem »Cinema Zion gelegen, so dass die »Kinoniterin« ihrer Leidenschaft, wann immer sie ein paar Piaster übrig hat, nachgehen kann – »Doch zuweilen lasse ich – Dichten dichten sein, und schöpfe Luft im Park auf der Filmseide eines Films« –, verfliegt schnell, denn auch Palästina ist doppelt: ist das Gelobte Land, der geträumte Märchenorient, und ist das Exil, in dem sie Mangel leidet an und wo sie nicht heimisch werden kann.
»Ihre plötzliche unentrinnbare Vereinsamung zwischen uns am Tisch im Freien. Es geht mir so oft genau so und dann ist man kahl an allen Ästen. (...) Immerfort sage ich leise, ich möchte wieder fort. Begreifen Sie das?«, schreibt sie bereits einen Monat nach ihrer Ankunft an den Maler Hermann Struck. Und schon Anfang September ist sie zurück in Zürich, und das trotz Einreiseverbot bis zum 31. 3. 1939!
Der Kampf um die Existenz wiederholt sich nun unter verschärften Bedingungen – im Herbst 1938 verliert sie die deutsche Staatsangehörigkeit und wird, wie die Schweizer das nennen, »schriftenlos« – ihre Heimatlosigkeit ist jetzt aktenkundig. Die Zürcher Fremdenpolizei erwägt daraufhin die Ausweisung, da sie »früher oder später gänzlich der privaten oder öffentlichen Wohltätigkeit zur Last fallen wird«, und verschickt Anfragen an ein knappes Dutzend Dienststellen. Prinz Jussuf kann es nicht fassen: »Ich habe doch das Buch geschrieben« – sie, die Dichterin, muss man doch achten wie in alten Zeiten die Propheten, die Gesichte hatten, wie das Kind, das geliebte jüngste, das träumt und die Träume deuten kann: »Im Sternenmantel trete ich ein wenn ich komme. Weitgereiste erfahrene Menschen, die helfen mein Geschick zu tragen in einer einzigen Hand. (...) Die meinen Namen nennen, die mich verwöhnen, die mich beruhigen, die mich trösten, die mit mir über den Dorn der Erde gehen.«
Stattdessen die alte Not. »Ich halt die Unruhe bald nicht mehr aus«, schreibt die »Petentin« an Emil Raas, »maschinel wurde mein Leben und eine Welle so wo im Winkel phantasiert. Ich tu das was mir nicht liegt, ich sprech das was ich nicht hören kann, ich blick an, was ich nicht sehen kann und so geht das den Tag über. Und immer zittere ich wie Laub an mir und in der Nacht hab ich Angst.«
Und wieder träumt sie vom Gelobten Land, als wäre es das Kindheitsparadies – könnte sie nur so einfach hinein wie in einen Spielzeugladen: »Heute habe ich mir im Spielladen hier lauter Indianersachen angesehen, mich schön zu erinnern. Ich habe mir dann zuguterletzt ein ganz kleines Wassergläschen gekauft ... Solch eine Freude füllt auch nicht mein Leben aus, aber einen Spielwinkel.«
Gott könnte kommen
Aber wie diesen »Spielwinkel«, in dem sie einzig existieren und schreiben kann, schützen, angesichts der Bedrohung? Nicht nur in Europa verdüstert sich die Lage – der »Anschluss« Österreichs im März 1938, der zahlreiche weitere Emigranten in die Schweiz bringt, im November die Pogrome in Deutschland und dann der Kriegsausbruch ein knappes Jahr darauf –, auch in Palästina herrscht Krieg zwischen Juden und Arabern. Und obwohl Else Lasker-Schüler gekommen ist, um mit »ihrem Volk« zu kämpfen, versteht sie und will sie diesen Kampf nicht: »Wir könnten doch alle Brüder sein. Die Araber doch unsere Brüder im Herzen«, schreibt sie aus Jerusalem an Carl Seelig.
Kindlich-rührend ist der Plan, den sie ihrem Gönner, dem Verleger und Herausgeber der Zeitung »Ha-Arez«, Salman Schocken, entwirft: »Ich hatte famose Pläne – z. B. – wir zusammen – zwei Direktoren eröffnen einen kleinen Jahrmarkt mit Karrossel. Ich weiß den geeigneten Platz nah, fast in Rehavia. 4–5 Buden vorerst, die so recht sind wie früher. Der Jahrmarkt – eine liebe reine Sache. Gott könnte kommen und sich mit den kleinen und großen Kindern freuen. So versöhnen wir zunächst das Volk Judas und des Arabers. (...) Holz ganz einfaches – Karrossel – schwer mit bunten Glasperlen behangen – Buden zum Zusammenklappen. Ich leite zuerst Karrossell mit hebräischen und arabischen kindlichenVolkliedern. Alle Kinder kommen von 4–9 Uhr abends, und sich liebende Menschen und freuen sich was. Auch ein Waffelbude. Was sagen Sie? (...) Karrossel gleich Versöhnung zwischen und Kennenlernen aller. Ich weiß sehr ehrlich Mädchen für Casse.«
So sind sie, die gut 500 Briefe und Karten und Telegramme des fünften Bandes der kritischen Werkausgabe, die, wenn auch der sechste im kommenden Frühjahr erscheint, abgeschlossen vorliegt. Geschrieben in diesem lächeln machenden kindlichen Dichterton, der urplötzlich in ein Zorn- und Eifersuchttremolo umschlägt, denn manchmal fühlt sich die Dichterin hintergangen oder betrogen, rächt sich dann in Worten und bittet kurz darauf kokettierend: »Nit böse sein?« Manchmal kalauernd paarreimend oder Frechheiten streuend, manchmal ehrlich bis zur Unvernunft. Sorgfältig ediert ist das alles, mit Angabe der Daten, Überlieferung, Besitznachweise, Poststempel und Adressen. Aber so recht glücklich wird man mit der Ausgabe nicht.
Der glitzernde Weg
Zum einen wünschte man, die Gegenbriefe – so weit überliefert – würden wenigstens als Regest wiedergegeben, denn allein mit Else Lasker-Schülers frei galoppierenden Satzfragmenten fühlt man sich oft hilflos, wüsste bei einer Briefschreiberin, die so sehr zu Mythisierung und Stimmungswechseln neigt und an Mussolini und den Papst schreibt, als säßen sie im Indianerzelt nebenan, doch gern, was der Briefpartner vorausschickte oder antwortete. Leider helfen auch die Anmerkungen oft nicht weiter – fallen allzu knapp aus oder fehlen ganz, oder sie sind vollkommen überflüssig. So wird zwar brav angeführt, dass der »Götz von Berlichingen« von Goethe sei, und langh und breit erklärt, dass »Solch ein Weg nach Rom, war noch nicht« auf die sprichwörtliche Redensart »Alle Wege führen nach Rom« anspiele – Briefe wie dieser aber: »Herr Professor Buber, mir scheint, hier Jerusalem ist nicht geeignet für Boxkämpfe oder irgend zu unfairen Angriffen«, bleiben unkommentiert!
Unbequem sind auch die Querverweise auf die anderen Bände der Ausgabe – zwingen sie doch den Leser dazu, bei der Lektüre alle Bände der Gesamtausgabe zum Nachschlagen griffbereit zu haben. Schon die Verweise im selben Band sind eine faule Fleißarbeit, denn statt des Verweises hätte man fast immer auch die Sache selbst angeben können – und dem Leser so das ständige Blättern und Suchen erspart. Das man im Übrigen ganz los wäre, wenn die Anmerkungen gleich als Fußnote auf der Seite stünden.
Die Dichterin aber? Sie war schon lange 1002 Jahre alt und herausgefallen aus der Märchenzeit in die Wirklichkeit. »Es hat mir immer so gefallen, wenn verirrte Kinder in Geschichtenbüchern endlich zwischen den hohen Stämmen den Weg glitzern sahen«. Das war ihr nicht vergönnt. Das Märchen ging nicht gut aus, sie fand nie wieder den Weg nach Hause, nicht mal in die Schweiz. Am Ende standen Armut, Krankheit und Tod. Sie starb am 22. Januar 1945, morgens kurz vor halb acht, und der Krieg tobte um sie und tobt noch heute, wo sie beerdigt wurde, auf dem Ölberg in Jerusalem.
»Muss denn immer eine Peitsche wo in der Ecke stehn. Wo ist David wo Jonathan? War es immer so?«
Else Lasker-Schüler: »Briefe 1937–1940«. Bearbeitet von Karl Jürgen Skrodzki und Andreas B. Kilcher. Jüdischer Verlag 2009, 606 Seiten, 114 Euro
FAS Nr. 21, 24. Mai 2009, Feuilleton Seite 26