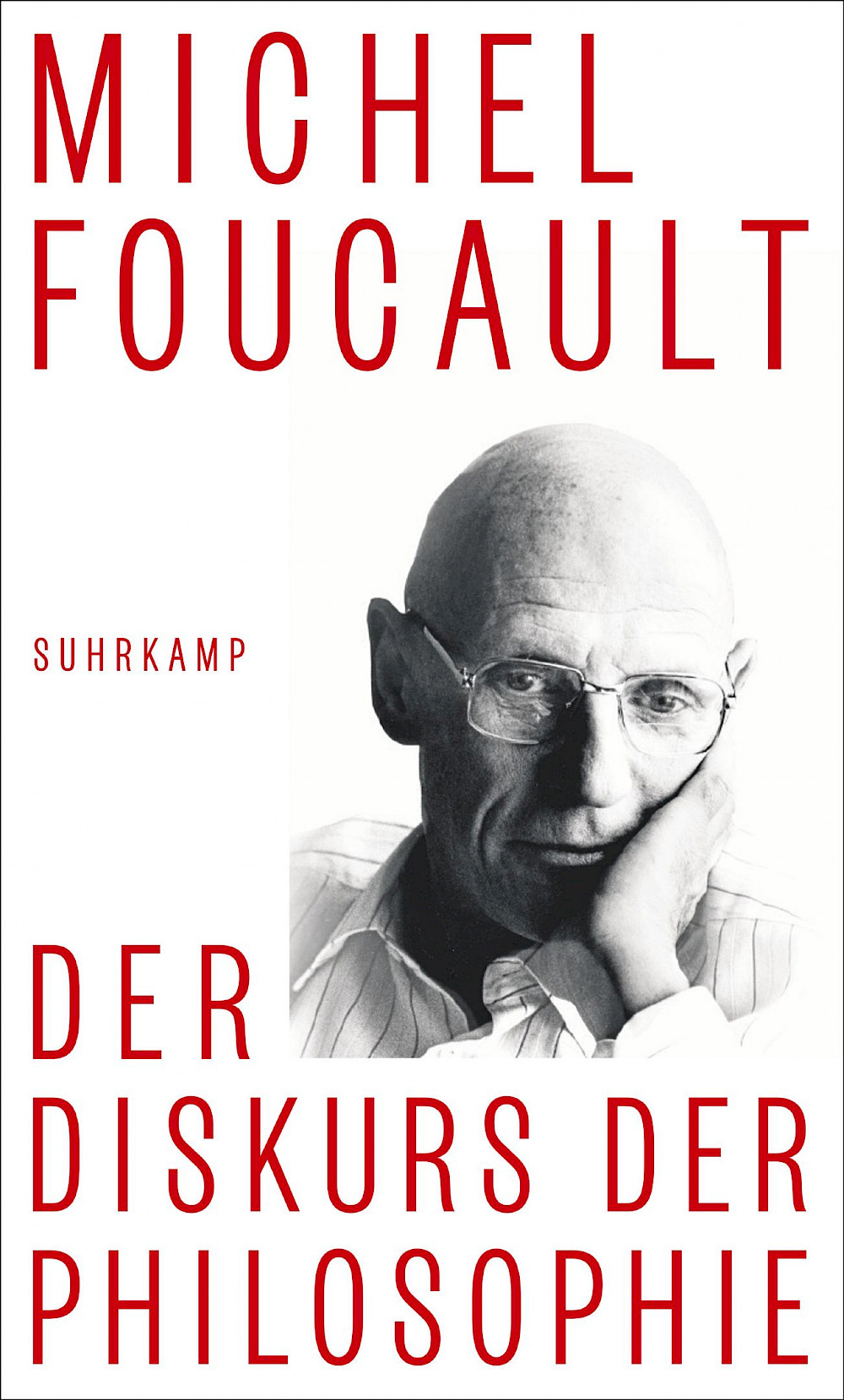[I. Kapitel] Die Diagnose
Es ist dieser seltsame Diskurs, der scheinbar keine Rechtfertigung hat, da er nichts »anderes« zu sagen hat, da er nichts erleuchtet, da er auf der Stelle tritt und keine Versprechungen macht, es ist dieser seltsame, lächerliche Diskurs, der die Philosophie in der diagnostischen Tätigkeit ausmacht, in der sie sich heute wiedererkennen muss. In der sie das Heute wiedererkennen muss, das ihres ist.
1 [...] »der Strukturalismus [kann] als philosophische Tätigkeit gelten, sofern man davon ausgeht, dass die Aufgabe der Philosophie die Diagnose ist. Der Philosoph will heute in der Tat nicht mehr sagen, was ewig existiert. Er hat die sehr viel schwierigere und flüchtige Aufgabe, zu sagen, was geschieht. In diesem Sinne kann man durchaus von einer bestimmten Art strukturalistischer Philosophie als einer Aktivität sprechen, die eine Diagnose des heutigen Geschehens gestattet«. [...] Die Idee von der Philosophie als Diagnose der Gegenwart wird für Foucault Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre wieder zentral, insbesondere bei seinen verschiedenen Lektüren von Immanuel Kants Text über die Aufklärung und bei der Ausarbeitung dessen, was er als »Ontologie der Gegenwart« bezeichnet. [...] In einem Interview in Japan im April 1978 erklärt Foucault, dass Friedrich Nietzsche der Erste war, der die Philosophie als »diejenige Aktivität definiert hat, die zu einem Wissen über das führt, was sich ereignet, und zwar jetzt«, und dem Philosophen somit die Rolle eines »Diagnostikers« der Aktualität zugeschrieben hat [...]. Im Oktober 1979 [...] nuanciert Foucault seine Aussage etwas: Er postuliert dann, dass, selbst wenn »Nietzsches gesamtes Werk zu diagnostizieren hat, was in der heutigen Welt geschieht und was das ›Heute‹ ist, diese von Kant aufgebrachte Fragestellung für die gesamte nachkantische deutsche Philosophie von [...] Hegel bis zur Frankfurter Schule charakteristisch ist [...]«.
3 [...] Die Vorbehalte und Kritik, die Foucault im Diskurs der Philosophie an Heidegger äußert, werden in einem im Herbst 1966 erschienenen Gespräch über die Frage der Diagnose aufgegriffen und erläutert: »Für [Nietzsche] war der Philosoph einer, der den Zustand des Denkens diagnostiziert. Man kann im Übrigen zwei Arten von Philosophen unterscheiden: Die einen eröffnen dem Denken neue Wege wie Heidegger; die anderen betätigen sich gewissermaßen als Archäologen; sie erforschen den Raum, in dem sich das Denken entfaltet, die Bedingungen dieses Denkens und seine Konstitutionsweise«. [...]
[II. Kapitel] Jetzt
Doch hier soll der philosophische Diskurs daraufhin befragt werden, was er zu sagen hat und wie er es sagt; was man herausfinden möchte, ist, wie er in der Lage ist, aus sich selbst das Heute aufzuzeigen, in dem er sich befindet, durch welches System er aus seinem eigenen inneren Ablauf heraus dieses »Jetzt« zeigt, während er spricht; und welche Art von Aktualität damit bezeichnet wird. Man versucht nicht so sehr, das zu entdecken, was mit dem philosophischen Diskurs zeitgleich ist (was, da es zur selben Zeittafel gehört, mit ihm »synchron« ist), sondern vielmehr das, was mit ihm »isochron«ist und sich über ihn als der »Moment« selbst bezeichnet, in dem er sich entfaltet.
[IV. Kapitel] Fiktion und Philosophie
Im Unterschied zu wissenschaftlichen Aussagen sind die Aussagen der Philosophie [...] nicht vom Jetzt ihrer Formulierung zu trennen: Das Hier, die Gegenwart, das Subjekt, das spricht, können niemals durch den Diskurs neutralisiert werden, der sich ausgehend von ihnen artikuliert. Die Anwesenheit eines Jetzt, das sie begrenzt, ist für die Philosophie unerlässlich. Und doch wird diese Gegenwart hier nicht so bezeichnet, wie sie im Alltagsdiskurs bezeichnet wird. Die Alltagssprache bezieht sich auf ein stummes Jetzt – auf einen Punkt im Raum, einen Augenblick in der Zeit, ein sprechendes Individuum –, das hartnäckig außerhalb des Diskurses bleibt [...] Die Philosophie greift dieses Jetzt, das sie bezeichnet, hingegen unaufhörlich wieder in sich auf; sie setzt es in ihrem eigenen Diskurs frei als Leuchtpunkt der Enthüllung in der Evidenz, als Bewegung der Wahrheit, die zu dem Moment ihrer Manifestation gelangt ist, als Selbstbewusstsein, das sich im reinen »Ich denke« erfasst. Daher hat sich die abendländische Philosophie als Lehre von der Evidenz, als Denken der Geschichte und als Theorie des Subjekts entfaltet.
Indem die Philosophie innerhalb ihres eigenen Diskurses die Triade des »Ich«, des »Hier« und des »Jetzt« bildet, die ihn Bestand haben lassen und aufrechterhalten soll, ähnelt sie einer anderen Diskursform: Diese könnte man als »Literatur« bezeichnen, aber es wäre genauer, sie »Fiktion« zu nennen. Denn die Fiktion beseitigt die Markierungen des Jetzt nicht, doch verweisen [diese] nicht auf eine stille Bestimmung der Menschen und Dinge; es ist nur sie, sie allein, die durch ihre Erzählung und durch tausend sich überschneidende Angaben diese Bestimmung schleichend nachzeichnet und verändert. Die Stimme, die in ihr spricht, hat keine andere Zeit und keinen anderen Ort als die, die sie sich selbst geben will. Und auch wenn es stimmt, dass diese Zeichen des Jetzt oft ungenau und wie über dem Leeren offen bleiben (man weiß nicht genau, wer diese seltsame Stimme ist, die »ich« sagt, woher sie kommt, seit wann sie spricht, nach welchem Zeitplan), ist es nicht so, dass sie auf die Realität einer Situation verweisen, für die es keine Worte gibt, vielmehr ist es so, dass ein Raum ohne Geographie, eine Zeit ohne Anfang und Ende, ein »Ich« ohne andere »Identität« als die der Grammatik durch den Diskurs der Fiktion als die – absichtlich verwischten – Markierungen ihres Sprechens konstituiert werden. Von daher ist der literarische Diskurs nicht ohne Analogie zur Seinsweise des philosophischen Diskurses. [...]
Wir haben bereits gesehen, dass die Philosophie immer eine Selbstrechtfertigung voraussetzt (die sich stark von der wissenschaftlichen Rechtfertigung unterscheidet): eine Art Autorisierung, die sich der philosophische Diskurs selbst erteilt, Zugang zur Wahrheit zu haben, die sich in ihm manifestiert. Seltsamerweise findet sich dieselbe Funktion in der Literatur wieder: freilich nicht in Form einer diskursiven Erklärung, aber als Hinweis, manchmal direkt, manchmal über Bande, auf den Zusammenhang zwischen dem, was erzählt wird, und der Stimme, die davon erzählt; es gibt keine Fiktion, die nicht auf die eine oder andere Weise sagt, wie sie sich einem Diskurs geöffnet hat, der jedoch nicht nur der Punkt ihrer Manifestation ist, sondern auch der Ort ihrer Geburt. [...]
Die Fiktion mag sich in einer spielerischen Freiheit selbst eine »Wahrheit« geben, die die Philosophie entdecken und beweisen muss, doch findet man bei der einen wie bei der anderen eine Funktion des Diskurses, die weder in der Alltagssprache noch in der Wissenschaftssprache anzutreffen ist: Diese Funktion, die vor jeder Trennung zwischen Verstand und Einbildungskraft, zwischen Rationalität und Nichtrationalität liegt, betrifft die Seinsweise des Diskurses; denn sie wird von jeder Gesamtheit von Aussagen erfordert, die das Jetzt ihres Sprechens nicht beseitigen kann, es aber dennoch rückstandslos in sich aufnehmen muss. [...] Wir haben gesehen, dass die Seinsweise ihres Diskurses impliziert, dass die Philosophie, zumindest in ihrer abendländischen Form seit dem 17. Jahrhundert, immer mit einer Theorie des Subjekts verbunden ist. Man kann sich fragen, ob die Seinsweise des literarischen Diskurses – wohlbemerkt mit denselben Markierungen der Geographie und Geschichte – nicht impliziert, dass er an eine bestimmte Fiktion des Subjekts gebunden ist [...].
Ihrem Wesen nach ist die Literatur ein Simulakrum: keine Reproduktion der Realität, keine Verdoppelung der Sprache über sie selbst, sondern eine Nachahmung des Diskurses.
Die Philosophie ist hingegen in keiner Weise eine Nachahmung. Auch wenn es stimmt, dass sie das Jetzt ihres eigenen Diskurses in sich aufnimmt, geschieht dies keineswegs, um es zu einem Quasi-Subjekt zu machen und sich selbst ausgehend von ihm als Analogon eines Diskurses zu entfalten; vielmehr geschieht dies, um von diesem Jetzt zu sprechen, um es selbst in Worte, Sätze, Diskurse zu transformieren, kurz, um es zu ihrem Gegenstand zu machen. Sie muss nicht von dem souverän in ihren Diskurs übernommenen Jetzt sprechen; sie muss von dem Jetzt sprechen, das ihr Diskurs in sich aufnimmt, um es zu rechtfertigen und um daraus eine Theorie zu machen. Deshalb ist die Philosophie nicht, wie die Literatur, ein Analogon zum Alltagsdiskurs, sondern eine Reflexion über das Jetzt, von dem aus (obwohl es jedes Mal anders ist) jeder Mensch sprechen muss, auch der Philosoph: Sie fragt also nach dem, was für ein sprechendes Subjekt ein Hier, eine Gegenwart sein kann, und danach, was zu sprechen genau ist. Daher die, zumindest seit Descartes bestehende, notwendige Nachbarschaft zwischen der Philosophie und den Theorien des Raums, der Zeit und der Sprache. Für jede Philosophie, die sich seit dem 17. Jahrhundert in der abendländischen Welt herausgebildet hat, ist es möglich und im Grunde ausreichend, Rechenschaft darüber abzulegen, was für sie Ausdehnung und Wahrnehmung, Zeitbewusstsein und Geschichte, die Formen und Regeln des Denkens sind, das im Diskurs artikuliert wird.
12 Seine berühmteste Kritik an dem, was er hier als »Mythos der Intimität« bezeichnet, arbeitet Foucault in seinem Text über Maurice Blanchot, »Das Denken des Außen«[,] aus, der im Juni 1966 in der Zeitschrift Critique (Nr. 229) veröffentlicht wurde. Mit seiner Behauptung, »das Sein der Sprache ist die sichtbare Auslöschung des Sprechenden«, und dass jedes Subjekt in der Sprache nur eine »grammatikalische Falte« bezeichnet, zitiert Foucault Blanchot, der in Celui qui ne m'accompagnait pas. Récit (Gallimard 1953) die Sprache als »ganz und gar außen« und eben »ohne Intimität« charakterisiert [...].
[V. Kapitel] Die Philosophie und der Alltag
[...] Dass das literarische Werk und in jedem Werk die Literatur mit dem Jetzt des Diskurses beginnt und endet, ist ein Zeichen für den irreduziblen Unterschied zwischen dem Literarischen und dem Alltäglichen. Dass der philosophische Diskurs dazu berufen ist, die gesamte Philosophie mit ihm beginnen und enden zu lassen, ist hingegen [ein] Zeichen dafür, dass er der Alltagssprache nahe ist.
Und so wie die Alltagssprache sich mit Dingen verbindet, dir schon da sind und später da sein werden, mit bereits gesprochener Sprache und mit Sprache, die später gesprochen werden wird, so ist auch der philosophische Diskurs mit etwas verbunden, das ihn umhüllt und sein Jetzt von außen umgibt; aber da der philosophische Diskurs [die] Macht hat, dieses Jetzt in sich aufzunehmen, kann ihm dieses Außen nicht fremd sein: Was es um das Jetzt des philosophischen Diskurses herum gibt (davor und danach), ist immer noch, in einer oft verborgenen, dunklen, schlecht ausgesprochenen, illusionären, unbewussten Form, Philosophie. Jeder philosophische Diskurs hat somit [eine] Beziehung zur Philosophie überhaupt. [...]
Die gesamte abendländische Philosophie ist seit Descartes im Grunde nichts anderes als das Vorhaben, zu wissen (und in einem grundlegenden Diskurs zu formulieren), was bislang nicht gewusst wurde; und das Vorhaben, zu sagen (und in einem spezifischen und grundlegenden Wissen zu wissen), was kein Wissen über sich selbst wissen kann.
[Die] Konstitution eines Wissens ohne Obskurität setzt voraus, dass die Kritik im Wesentlichen eine Analyse der Illusion ist: nicht die Widerlegung des Irrtums (was die Aufgabe jedes wissenschaftlichen Diskurses ist), sondern das Aufzeigen dessen, was den Irrtum unvermeidlich macht, solange man seine Voraussetzungen und Mechanismen nicht genau kennt. [...] Die andere Aufgabe der Philosophie [...] besteht darin, hinter alle positiven Diskurse, alle Behauptungen des Wissens, alle bewiesenen oder empfangenen Formen der Wahrheit zu gelangen, um ihre notwendigen Bedingungen zu definieren. Das heißt, es geht ihr nicht so sehr darum, die Illusion zu ermitteln, sondern vielmehr darum, das aufzudecken, was das Wissen und der Diskurs nicht über sich selbst wissen: den Grund ihrer Möglichkeit, die Formen, die sie bestimmen, die Grenzen und Horizonte, die sie nicht überschreiten können, die Handlungen, die sie konstituieren. [...] Der universelle Diskurs, den die Philosophie über die Welt zu führen versucht, ist nicht so sehr die Totalisierung allen positiven Wissens als vielmehr die Aussage des Diskurses, der durch die Analyse der Illusion und der Wurzel des Irrtums die unbestimmte Entfaltung wahrer Diskurse möglich machen wird; die Aufdeckung all dessen, was in der Erfahrung unbewusst bleibt, ist nicht die Entdeckung einer anderen, dunkleren und besser verborgenen Realität, die nach einem neuen positiven Diskurs analysiert werden müsste, sondern die Aussage der Formen, die alle Diskurse bestimmen, die man über die Welt haben kann. Die Konstituierung eines universellen Wissens auf der Grundlage einer Analyse der Illusion und die Analyse der Konstituierung des Wissens auf der Grundlage der Bewusstwerdung des Unsichtbaren sind in der Tat nur die zwei Gesichter derselben kritischen Funktion, die im Abendland der Diskurs der Philosophen seit Descartes unaufhörlich ausgeübt hat.
Daraus entstand für die Philosophie zweifellos ein Projekt, von dem sie sich schwer zu trennen scheint: das Projekt, eine Aufklärung zu sein, die radikal und universell genug ist, um das Gesicht der Welt zu verändern. Vom Philosophen des Abendlandes wird nicht verlangt, die Macht zu übernehmen oder das technische Wissen zu entwickeln, das erlauben würde, das Leben der Menschen zu verändern, sondern diese Menschen zu fordern, sie zu einer Bewusstwerdung zu zwingen, die das gesamte System ihrer Erkenntnis begründet, all ihre Hirngespinste zerstreut und die ganze Wahrheit der Welt in einem Diskurs aussprechbar macht, der von nun an durch nichts mehr unterbrochen würde. [...] die Rolle der Philosophie besteht darin, aus dem Alltagsdiskurs alles zu vertreiben, was er an Naivität, an Unkenntnis seiner eigenen Bedingungen und folglich an Illusorischem und Unbewusstem haben kann; ihre Rolle besteht also darin, die Alltagsprosa der Welt auf die Ebene eines philosophischen Diskurses zu bringen, der spontan jeden Tag erfolgt und dessen Jetzt unbegrenzt alle Daten des Kalenders, alle Regionen der Welt und alle sprechenden Subjekte einnehmen würde. Die ganze große Chimäre des Abendlandes ist seit Descartes weder der Philosophenkönig noch der weise Philosoph, noch der Philosoph, der die natürliche Ordnung der Welt ausspricht; es ist der Philosoph, der den Alltag (den der Wissenschaft wie den des Lebens) allein durch den Einbruch des Lichts verändert. Unsere gesamte Kultur hat von einer Bewusstwerdung geträumt, die eine Revolution wäre.
[VI. Kapitel] [Die Geburt des philosophischen Diskurses]
[...] Was sich grundlegender ändert als die Dinge, die gesagt werden, oder die Menschen, die sie denken, während sie sie sagen, ist die Einbeziehung des sprechenden Subjekts in das Innere des Diskurses und die Bezeichnung dieses sprechenden Subjekts im Äußeren dieses Diskurses; auf der gesamten Oberfläche des Diskurses überhaupt [...] erscheinen neue Formen dieser bezeichnenden Einbeziehung, wobei jede von ihnen einen neuen Diskursmodus definiert. [...] Man glaubt gerne, dass sich die großen kulturellen Veränderungen zwischen dem Denken und den Dingen abspielen, dass man manchmal beginnt, anders zu denken (wahrzunehmen, zu klassifizieren, die Dinge zu verknüpfen), und dass umgekehrt die Dinge dem Denken in neuen Profilen und in einer bis dahin [...] Ordnung erscheinen. Aber bevor sich die Diskurse in ihrem Inhalt (in dem, was sie sagen) oder in ihrer Form (in ihrer Anordnung und inneren Verkettung) ändern, müssen sie sich in ihrem Modus ändern, das heißt in der Art und Weise, wie sie von einem Hier, einem Jetzt, einem sprechenden Subjekt aus verlaufen, und der Art und Weise, wie sich dieser Untergrund aus dem Diskurs selbst heraus bezeichnet und entfaltet. [...]
[VII. Kapitel] Die Geburt des philosophischen Diskurses
[...] Kants Revolution bestand darin, anstatt wie die Klassiker den Status der Metaphysik durch die Beseitigung der Ontologie zu verändern, die Metaphysik durch eine neue Form von Ontologie abzuwehren. Diese neuartige Ontologie hat den Zweck, eine allgemeine Theorie des Gegenstands zu bilden, wie er sich der Erfahrung bietet: Sie ist mit einer Phänomenologie also entweder identisch oder ihr sehr ähnlich oder eng mit ihr verbunden. Das heißt, der Diskurs hat keinen Beweis der Existenz mehr zu erbringen, er muss in der Erfahrung nicht mehr zwischen dem unterscheiden, was existiert, und dem, was nicht existiert; er muss eine Theorie dessen aufstellen, was in ihr in Erscheinung tritt und sich als Gegenstand bietet. [...]
[XIV. Kapitel] Die Geschichte des Diskurs-Archivs
Es gibt in jeder Kultur, selbst wenn die Schrift dort nicht bekannt ist, eine Dimension des Diskurs-Archivs; denn es gibt immer Formen der Aufzeichnung, Übertragung und Wiederholung von Diskursen; es gibt Riten, die sie zwangsläufig in Gesten, Operationen oder Zeremonien einbinden; es gibt Verbote und Regeln für die Zirkulation der gesprochenen Worte. Und tatsächlich ist ein Großteil dessen, was wir in unserer Kultur über fremde Kulturen wissen, dem Archiv entnommen, das diese Kulturen spontan anlegen. [...] Das bedeutet, dass es für eine Kultur, welche es auch sei, (selbst wenn sie sich genauso wie unsere mit ihr fremden oder früheren Kulturen befasst) niemals möglich ist, aus ihrem eigenen System des Diskurs-Archivs auszubrechen. Eine Kultur hat nur im Element ihres Arcivs und in den Formen ihres eigenen Diskurses Zugang zu dem, was nicht sie selbst ist; dies sind für sie Grenzen, die unüberwindbar sind. Unter diesen Voraussetzungen wird deutlich, dass die Analyse des eigenen Archiv- und Diskurssystems einer Kultur notwendig an ihre Grenzen stößt, die sie nicht überschreiten kann
Wenn eine Kultur wie die unsere über sich selbst nachzudenken beginnt, stößt sie mehr oder weniger schnell an ihre eigenen Grenzen: die Grenzen ihrer Sprache, ihrer Denkformen, ihrer Grundkonzepte, ihrer Existenzbedingungen; sie stößt auch auf die Trennungen, die sie zwischen wahr und falsch, gut und böse, Wahnsinn und Vernunft vornimmt. Diese Grenzen können durch den Rückgriff auf eine andere Analyseebene jedoch stets umgangen werden [...]. Das System des Diskurs-Archivs setzt der Kultur hingegen Grenzen, die sie nicht überwinden kann: Denn dieses System bestimmt, welche Aussagen sie artikulieren kann, welche Dinge es wert sind, gesagt, aufbewahrt und wiederholt zu werden, welche Dinge auf der Ebene der Sprache nicht existieren – damit überhaupt nicht existieren, welche Dinge verschwiegen werden müssen etc. Es ist also per Definition nicht möglich, dass eine Kultur dieses System überschreitet, um etwas auszusprechen, was sie nicht sagt, um Diskurse zikulieren [zu lassen], die sie nicht zulässt: Denn sobald sie formuliert werden, sind sie bereits Teil des Archivs und des Diskursuniversums. Unter diesen Voraussetzungen ist klar, dass eine Kultur nie wirklich ihre eigene Ethnologie betreiben kann, das heißt all ihre Grenzen überschreiten und sich selbst strikt als ein äußeres Objekt behandeln kann; sie wird nur partielle ethnologische Analysen vornehmen können, bei denen sie in diesem oder jenem bestimmten [Punkt] ihre Grenzen überschreitet, indem sie sich mit anderen Zivilisationsformen vergleicht. Was eine allgemeine Ethnologie ihrer selbst betrifft, so kann eine Kultur diese niemals erreichen: sie kann höchstens die absoluten und unweigerlich blinden Grenzen, die ihr das System ihres Archivs und ihres Diskurses vorschreibt, von innen heraus und gleichsam durch ein Herantasten erforschen. Mit anderen Worten: Wenn unsere heutige Zivilisation versucht, eine Ethnologie anderer Kulturen zu erstellen, muss sie deren Diskurs-Archiv neben anderen ebenso wichtigen und vielleicht viel grundlegenderen ethnologischen Merkmalen untersuchen; wenn sie hingegen versucht, einen radikal ethnologischen Blick auf sich selbst zu richten, begibt sie sich in das unüberwindbare Element des Diskurs-Archivs und kann nichts anderes tun, als sich auf unbestimmte Zeit auf die immer enger werdende Grenze zuzubewegen. Die Analayse des Diskurs-Archivs fungiert als eine Art immanente Ethnologie: als Bewegung in Richtung dessen, was als Bedingung, Element und Raum für alles dient, was wir sagen und denken können.
[XV. Kapitel] Der heutige Wandel
Das aktuelle Ereignis, das den Diskurs als allgemeines Referential einführt, [...] besteht nicht in der Entdeckung oder Wiederherstellung eines ersten Textes, eines anfänglichen und ewigen Sprechaktes, sondern in einer Bewegung, die unserer Kultur eigen ist und die die Diskursivität zur allgemeinen Form dessen macht, was der Erfahrung gegeben werden kann. Doch welche Bedeutung ist dem Begriff der »Diskursivität« zu geben, und in welchem Sinne hat man das Recht zu sagen, dass sie die Form all dessen ist, was der Erfahrung gegeben werden kann? Die Diskursivität ist nicht die Eigenschaft von etwas, das einen verborgenen Diskurs in sich birgt; sie ist auch nicht die Eigenschaft einer Konfiguration, deren Elemente untereinander die gleichen Beziehungen unterhalten würden wie die Elemente eines Diskurses; sie ist die Möglichkeit, in einen Diskurs transformiert zu werden. [a]
[a] Foucault hatte zuerst geschrieben und dann durchgestrichen: »In welchem Sinne kann man sagen, dass die Diskursivität nicht nur für diese allgemeine Form gehalten wurde, sondern dass sie dies tatsächlich geworden ist? Unter Diskursivität ist weder eine Serie realer Aussagen zu verstehen, die insgeheim die Erfahrung beleben, noch eine Struktur der Sprache, die ein universelles Prinzip der Intelligibilität wäre; sie ist so zu verstehen, dass von nun an nur der Diskurs oder das, was gegenwärtig in einen Diskurs transformiert werden kann, Existenz oder Realität hat; und wenn man bedenkt, dass eine der Eigenschaften des Diskurses gerade darin besteht, immer in einen neuen Diskurs transformiert werden zu können, wird man sagen, dass heute alles, was in einen Diskurs transformierbar ist, existiert, doch nur das.«
Wie [aber] kann etwas, das kein Diskurs ist, so verändert werden, dass es zu einem Diskurs wird? Es ist bekannt, wie das Problem traditionell gelöst wurde: Was nicht Diskurs ist, wird im Element und durch die Vermittlung der Repräsentation diskursiv. Indem diese die Dinge der Reflexion und Analyse zugänglich macht, erlaubt sie, ihnen ein Ensemble von Zeichen zuzuordnen, die, miteinander verbunden, den Diskurs bilden. [...] Tatsächlich reicht die Vermittlungsfunktion der Repräsentation jedoch nicht aus, um die radikale Unmöglichkeit dieser Transformation zu verschleiern: Wenn ein Ding ein Zeichen erhält, dann indem es Teil eines Diskurses sein kann, indem sein Platz in einer ganzen Reihe von Aussagen tatsächlich angelegt ist, noch von außen gezeichnet und wie leer gelassen. Das Zeichen ist kein elementarer Bestandteil des Diskurses: Es ist dessen ausgearbeitetes Produkt. Wenn man sich in Erinnerung ruft, dass der Diskurs als das allen möglichen Aussagen immanente System definiert wurde, begreift man, dass allein der Diskurs die Bezeichnung – die Herstellung einer Zeichenbeziehung zwischen einem »Ding« und einem »Wort« – bestimmt. Man kann also nicht sagen, dass das Ding ein Zeichen erhält oder dass die Zeichen die Dinge zerschneiden und sie in ihrer Individualität erscheinen lassen; oder vielmehr sind diese beiden Propositionen nur vor dem Hintergrund des bereits existierenden und entfalteten Diskurses wahr. So sehr, dass die »Transformierbarkeit« in Diskurse immer nur eine Eigenschaft des Diskurses selbst sein kann. Unter diesen Umständen ist ersichtlich, dass nur das, was der Diskurs ist, existieren und der Erfahrung gegeben werden kann. Die Diskursivität, durch die sich die Erfahrung definiert und die ihr eine Möglichkeit verleiht, kommt immer nur dem Diskurs selbst zu.
Michel Foucault, Der Diskurs der Philosophie