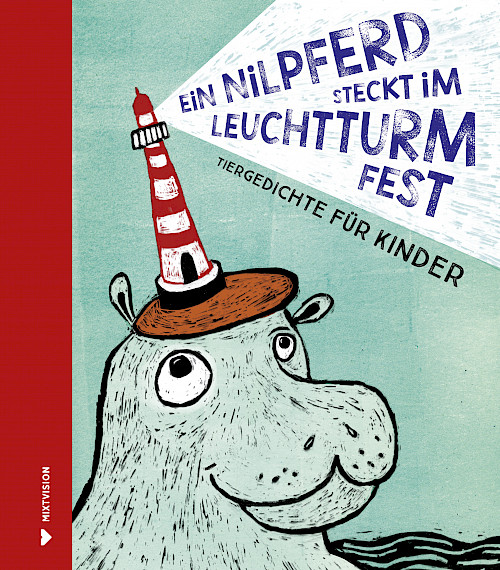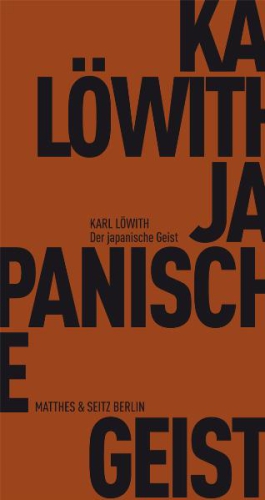Fortschreiten in verschneiter Landschaft
Mit Claude Simon durch den Wald reiten und erfahren, was Literatur ist
Claude Simon war ein Schriftsteller des Auges, heißt es. Sein Blick wurde oft als ein fotografischer beschrieben. Sein Stil als eine Montage isolierter Momentaufnahmen.
„Progression dans un paysage enneigé“ (Fortschreiten in verschneiter Landschaft) heißt einer der kurzen Texte, die der 2013 bei Matthes & Seitz erschienene Band „Archipel / Nord“ zusammen mit Fotografien Simons, zwischen 1937 und 1970 aufgenommen, versammelt. Er ist exemplarisch für Simons Arbeitsweise, die er selbst als bricolage, Bastelei, bezeichnet hat. Ein Reiter, ein Soldat, ein Kavallerist, reitet allein auf seiner fuchsroten Stute durch einen verschneiten Wald. Simon beschreibt die Bewegung des Pferds, die Kälte, die Farben, die Gerüche, die Geräusche, das Licht, das Herabfallen des Schnees von den Zweigen, das Schmelzen der Schneeflocken auf der Kruppe des Pferds, auf den Lippen des Mannes, wie sich die glitzernden Kristalle in den Falten des Mantels sammeln. Reiter und Pferd bewegen sich durch das Waldstück, und der Text bewegt sich durch die Sprache. Denn Simon bietet drei Variationen zum selben Thema, es ist immer derselbe Wald, dasselbe Pferd, derselbe Reiter, derselbe Ritt unter den verschneiten Bäumen dahin. Aber Simon verschiebt die Aufmerksamkeit mal mehr zum Wald, zu den Bewegungen des Pferdes, zu den Empfindungen der Kälte. Er versucht, das Zugleich des (Erinnerungs-)Bildes, die Momentaufnahme, den Augenblick, in die lineare Abfolge der Wörter zu übersetzen. Das ist unmöglich, und er weiß es. Aber in der Unmöglichkeit gelingt Simon eine immer größere Genauigkeit, Perfektion der Beschreibung.
Auf wenigen Seiten kann man hier Simons Arbeitsweise studieren, wie der Text sich selbst voranträgt, fortschreitet, nicht weil ein Plot, ein Dialog ihn treibt, sondern indem die Sprache sich einen Weg sucht, erst ohne Umwege, dann immer verzweigter. Es bildet sich, mit der Zunahme der beschriebenen Details, ein Sprachdelta, das zwar immer noch eine Hauptrichtung kennt, ein syntaktisches Gefälle dem phraseologischen Ende einer begonnenen Bewegung zu, in die es ruhend mündet. Aber es gibt innerhalb dieses rhythmischen, melodischen Gefälles keine Hierarchie, keinen Helden, keine Handlung, der Fokus der Aufmerksamkeit verschiebt sich innerhalb des Bildes, das sich mit der Beschreibung entwickelt, Nuancen eröffnet, Ungenauigkeiten, weil Anschlüsse nicht stimmen oder abrupt enden. Das Ende aber könnte immer ein neuer Anfang sein.
Das Lesen macht ruhig, lässt verweilen, führt in die verschneite Landschaft, in die Sprache. Gerade die variierte Wiederholung erlaubt eine Aufmerksamkeit auf beides, auf das, was erzählt wird (denn natürlich gibt es, wenn auch keinen Plot, dennoch eine Bedeutung, einen Sinn), und darauf, wie es erzählt wird. Das Lesen ist wie ein Waschen der Augen, des Blicks, man sieht genauer, schweift zurück, vergleicht, studiert die Technik, die filmisch ist. Kamerafahrten, Zoom, Montage. Weiche Übergänge und harte Schnitte. Wechselnde Kadrierungen. Allerdings treten Empfindungen hinzu – die Perspektive wechselt von Außen nach Innen, es ist die Rede von der Kälte, die der Reiter in den Füßen spürt, und Simon selbst gibt die Vergleiche, Metaphern, die Sinnlichkeit des Haptischen, der Gerüche, des Geschmacks, die beim Film erst der Zuschauer durch das Zusammensetzen der montierten Bilder erschafft oder durch seine eigenen Assoziationen und Erfahrungen.
Simon zu lesen ist anstrengend. Diese kurzen Texte zeigen, weshalb. Man muss wach sein, immerfort, jedes Detail beansprucht dieselbe Aufmerksamkeit, es gibt nicht Vorder- und Hintergrund, keine Perspektive, keinen Rahmen, es gibt nur eine Fläche. Auf ihr sucht man herum, sucht, was zusammenzugehören scheint, ordnet an, verwirft, stellt scharf, sucht neue Verbindungen.
Simons Stil kommt aus einer existenziellen Erfahrung, die er selbst als eine Umkehrung alles bis dahin Gelernten, Erfahrenen, Gewussten beschrieben hat. Im Mai 1940 war er mit seinem Kavallerieregiment im Norden Frankreichs im Einsatz, als die Einheit von deutschen Panzern beschossen wurde. Alle kamen ums Leben, bis auf zwei Mann. Simon war einer von ihnen. Er wurde aus dem Sattel geworfen, war bewusstlos – der Moment zwischen Getroffen-Sein und Bewusstlosigkeit aber war unauslöschlich. Er war mit der Ahnung in den Krieg gezogen, zu sterben, sah sich in der Nachfolge seines Vaters, der, da war Simon noch nicht mal ein Jahr alt, im August 1914 vor Verdun gefallen war. Und jetzt, so schien es ihm, war er wirklich da, der Tod, der eigene, das Sterben ganz nah.
Roland Barthes sagt, jeder Künstler habe, wie Dante, sein vita nova-Erlebnis, nicht unbedingt in der tatsächlichen Mitte seines Lebens, sondern in der gefühlten, in dem Moment, da er sich als Künstler geboren fühlt, seinen Stil, sein Thema, die Quelle, aus der er inhaltlich wie formal schöpft, gefunden hat. Für Simon war das der Krieg. Der Krieg, so sagte Simon später, habe ihn gelehrt, gewisse Dinge richtig zu sehen. Die nackte Existenz. Den Tod als eine Tatsache, die einen selbst betrifft. Die Dissoziation des Geschehens. Das Zugleich Tausender Ereignisse, Empfindungen, ohne Ordnung. Einen unbändigen Lebenshunger. Denn in dem Augenblick, in dem Simon glaubte, zu sterben, spürte er eine nie gekannte Lebensgier, sah die Schönheit der Welt, Himmel, Wolken, Gras, wie nie zuvor.
Er überlebte, kam in Gefangenschaft, konnte, als er nach Bordeaux verlegt wurde, aus dem Lager fliehen, schlug sich nach Perpignan durch, wo die Familie der Mutter Weingüter besaß. Dort begann er zu schreiben. Was ihn antrieb, war der Wunsch, die existentielle Erfahrung auszudrücken, mit den Mitteln der Sprache. Dazu musste er die Sprache selbst zum Protagonisten und Forschungsgegenstand machen, Syntax und Interpunktion auseinandernehmen, zu seinem individuellen Ausdrucksmittel formen, das in der Lage war, seine Erfahrung und die einer ganzen Generation zu transportieren.
Er nannte das „réalisme subjectif“: unmittelbare Wiedergabe der Erfahrung ohne erklärenden Bericht. Nur die nackten Fakten, Erlebnisse, kein Fabulieren, parallel angeordnetes Material, Wiederholungen, keine Hierarchie, keine Chronologie. Aber natürlich gelang das nicht. Die unmittelbare Erfahrung ist die unmittelbare Erfahrung und durch nichts, sei es noch so gekonnt, substituierbar. Aber es wurde Literatur daraus, große Literatur.
Claude Simon: »Archipel / Nord«. Kleine Schriften und Photographien. Aus dem Französischen von Eva Moldenhauer. Mit einem Vorwort von Brigitte Burmeister. Matthes & Seitz 2013, 176 Seiten, 22,90 Euro
fixpoetry, 17. Februar 2015