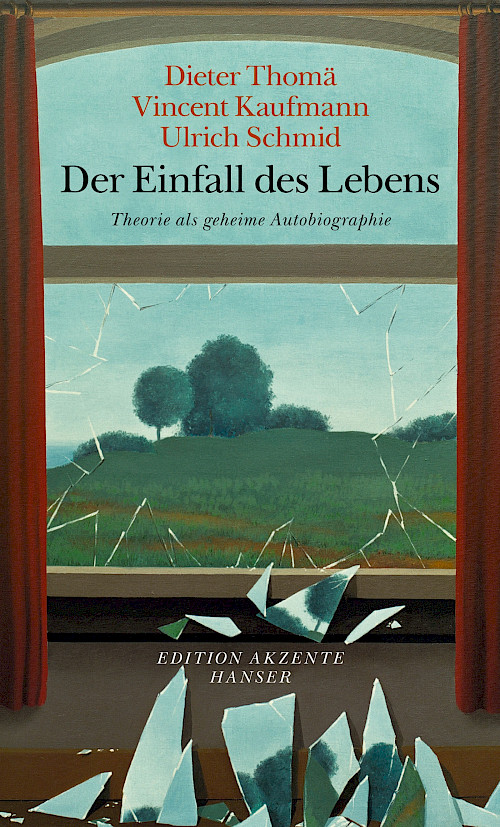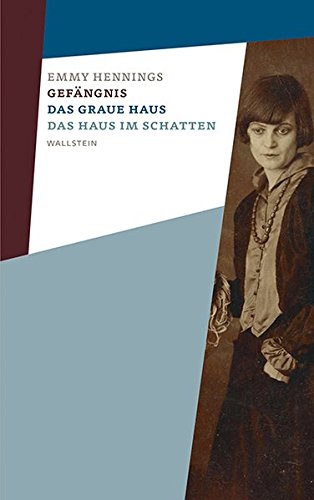Die Lyrik, wie jede Kunstgattung, macht immer wieder dürre Zeiten durch. Die letzten zehn Jahre aber haben geleuchtet. So sehr, dass es selbst dem lyrikfernen und immer lyrikferneren Feuilleton auffiel und es sich hin und wieder zu panegyrischen Sonderseiten hinreißen ließ; die »Zeit« druckte gar ein Jahr lang Gedichte, die sich auf mehr oder weniger aktuelle politische Ereignisse und Vorgänge bezogen. Den Versuch, die ästhetische Qualität der entstandenen Texte zu bestimmen, unternahm sie jedoch nicht.
Das gilt fast allgemein. Gedichtabdruck und PoetInnenporträts machen zwar auf das Phänomen des neugewonnenen dichterischen Reichtums, auf Zeitschriften- und Verlagsneugründungen, die sich nicht nur der Vielfalt der poetischen Stimmen verschrieben, sondern gar die »Poesie als Lebensform« (Kookbooks) entdeckt haben, aufmerksam, gehen aber über bloßes hinweisendes Staunen selten hinaus – und schon gar nicht ersetzen sie die (literarische) Kritik. Ihre Aufgabe wäre es ja, nicht nur zu sammeln, sondern zu sichten, und das Gesichtete einzuordnen und zu bewerten.
Dass ein sprachliches Kunstwerk so sehr einzuschüchtern vermag, und zwar umso mehr, so scheint mir, je größer seine Qualitäten sind, ist verwunderlich. Ein Gedicht verlangt ja erst einmal nicht mehr, als dass wir uns für seine Bewegung öffnen, das heißt seinem Klang, seiner syntaktischen Struktur, der Offenheit oder Geschlossenheit seiner Form, der Polyvalenz und Schönheit seiner Sprache sowie den Assoziationen, die sie in uns auslöst, überlassen, ihm vertrauen und unseren eigenen Emotionen uns anvertrauen: Freude, Verwirrung, Langeweile, Begeisterung, Erschauern, Furcht. Etwas, was uns beim Hören eines Musikstücks vollkommen klar ist. Seinen ästhetischen Überschuss zu reduzieren auf eine Bedeutung, seine emotionale Spannung, seine sinnliche Verführungskraft aufzulösen in kommunizierbares Verständnis käme uns nicht in den Sinn.
Auch das Gedicht will keine Verständigung über den »Inhalt“ herstellen. Es will vielmehr, wovon es spricht, erzeugen. Was es sagt, sagt es an der Oberfläche, nicht in einem Dahinter, das erst mehr oder weniger umständlich zu entbergen wäre – und das man dann hat. Sprache dient dabei nicht, wie in der Alltagskommunikation, als Mittel, sondern als Material. Je lyrischer ein Gedicht ist, das heißt, je mehr es sich von den erzählenden Gattungen, der Ballade zum Beispiel, entfernt, je dichter seine innertextuellen Fäden gesponnen, je feiner und reicher seine lautlichen Strukturen, je vielfältiger und komplexer seine formalen Bezüge sind, desto schwieriger (und fragwürdiger) wird es, es auf seinen Inhalt zu reduzieren, nach seiner Bedeutung oder seinem Sinn zu fragen. Die Paraphrasierung der Lyrik zerstört, was sie ausmacht: grafische Gestalt, Metrum, Rhythmus, Stil, Klang, Metaphorik. Ein wesentliches Merkmal der Lyrik, die Wiederholung (Metrum, Reim, Refrain etc.) etwa, ist rein inhaltlich betrachtet irrelevant, sie dient vor allem dem ästhetischen Vergnügen. Das sinnliche Material ist nicht ablösbar von seinem Inhalt, der Inhalt nicht ablösbar vom sinnlichen Material. Zu fragen wäre eher, wie und warum es wirkt.
Einen ersten Überblick über die jüngere deutsche Gegenwartslyrik konnte man bereits in der 2003 von Jan Wagner und Björn Kuhligk herausgegebenen Anthologie »Lyrik von jetzt« gewinnen. Hier wurde die neue Generation der Dichterinnen und Dichter mit je vier Gedichten in ihrer Formenvarianz und Vielstimmigkeit erkennbar. Natürlich haftet einer Auswahl immer etwas Willkürliches an, nicht nur mit Blick auf die Aufgenommenen, sondern auch durch die Behauptung, die Autoren und ihre Texte würde mehr verbinden als ihr Geburtsjahr, das sich zufällig innerhalb der gleichen Jahrgangsspanne findet. Die Inszenierung von Generationalität hat auch stets die Funktion, sich abzugrenzen von den (wenig) Älteren, der Tradition, in der man steht, und ist Ausdruck des Versuchs, eine neue zu beginnen.
Neben dieser vordergründigen Grenzziehung, die sich mehr oder weniger subtil gegen das Etablierte, Fad-Bekannte, die allzu lang gestrickte Masche richtet, findet eine solche scharfe Markierung aber darin ihre Berechtigung, dass sie rein subjektiv anmutende Erfahrungen, individuelle Erschütterungen zu denen einer (mit-)geteilten Gemeinsamkeit bündelt. Dies zeigte sich an dem zu Beginn des Jahrzehnts schon fast inflationär gebrauchten lyrischen »wir«, bei dem man oft nicht so recht wusste, wie und aus wie vielen Einzelnen es sich zusammensetzte, ob das nur ein Du und ein Ich war oder eine ganze Gruppe, eine auf Distinktion und Exklusion bedachte In-Group, denn ziemlich selbstreferentiell und undialogisch wirkte dieses Wir, allzu scharf seine Abkapselung vom Leser. »Wäre das bereits die kleinstmögliche Gruppe, wenn ich mit meinem lyrischen Ich unterwegs bin, mit meinem Subjektivitätsdummy, mit meinem persönlichen Container für Metrik und Fleiß?«, fragte Monika Rinck (»Ah, das Love-Ding!«, Kookbooks 2006). Und ja, kaschierte dieses ominöse lyrische Wir nicht eine überindividuelle schizoide Haltung: sich der Welt gegenüber solipsistisch einzuspinnen, während es doch eine Verständigung von Ich zu Ich versucht? Damit aber wäre es ja gerade Ausdruck der Gegenläufigkeit der Bestrebungen, die am Beginn einer jeden sich konstituierenden künstlerischen Strömung steht: das individuelle künstlerische Potential zu verbinden mit dem einer Gruppe. Und so ist die Sammlung von Wagner und Kuhligk eben nicht nur Abbild des vorgefundenen Materials, sondern auch Steinbruch für weitergehende Auseinandersetzung und Entwicklung.
Und diese war, wenn man den Wagner-Kuhligk-Band als Gründungsdokument der jetzt Endzwanziger bis Anfangvierzigjährigen nimmt, von denen eine ganze Zahl inzwischen mit eigenen Lyrikbänden hervorgetreten ist, eine glückliche. Nicht nur mit Blick auf ihre primäre poetische Produktion, sondern auch poetologisch. Die Selbstverständigung, die ab der Mitte des zurückliegenden Jahrzehnts die lyrische Produktion zunehmend begleitet und reflektiert hat und in der es immer wieder darum ging, das Dichterische an der Dichtung, das »lyrische Potenzial«, wie Anja Utler es nennt, zu bestimmen, zeigt dabei – wie die Dichtung selbst – nicht nur eine genaue Kenntnis der lyrischen Tradition und des undogmatischen Umgangs mit ihr, sondern auch eine fruchtbare Entgrenzung: Nicht nur dass die deutsch-deutsche Vereinigung unter den jungen Lyrikern gelungen ist, auch was die Dichterinnen und Dichter seit jeher getan haben, zu übersetzen, hat mit der internationalen Vernetzung der literarischen Szenen noch zugenommen und wird mit Lust betrieben – und anders als in der Prosa, wo der angloamerikanische Kulturraum kaum verlassen wird, gehen die Streifzüge der deutschen Dichterinnen und Dichter auch ins Romanische, Slawische, Arabische, Ostasiatische. Der Gewinn aus diesem polyphonen Anregereservoir ist groß, an jeder fremden Sprache hängt schließlich eine ganze Kultur – deren Töne sich dann in den eigenen Texten niederschlagen: vordergründig als Fremdsprach-Implantate, hintergründig als metrische Struktur, syntaktische Verknappung, Versschema, Bildbrechung. Der Höhenflug der jüngeren deutschsprachigen Gegenwartslyrik hat sich nicht zu geringen Teilen dieser Durchlässigkeit für die fremdsprachige Dichtung zu verdanken.
Zugute kommt den Dichterinnen und Dichtern dabei, dass die Lyrik eine Kunstgattung ist, die sich der kommerziellen Verwertbarkeit fast komplett entzieht. Die geringe Rezipientenzahl, die oft bedauert wird, hat zumindest den einen großen Vorteil: dass sie keinen Kompromiss im Anspruch erzwingt. Dass in der Literatur alles erlaubt ist – die Prosaschriftsteller haben es weitgehend vergessen (ein Band wie Ann Cottens »Florida-Räume« ist rühmliche Ausnahme). Die Lyrik aber zeigt: Es gibt andere Realitäten, gleich nebenan, wagemutige, irrlichternde, verträumte, gespannte, freche, verrückte, intelligente, kopfverdrehende, sinnliche, welterzeugende.
Naturlyrik und (modernes) Biedermeier (Bossong, Wagner, Poschmann, Gumz, Schulz, Falb)
Obwohl, ähnlich wie in der Neuen Musik, auch in der Lyrik die Verbots- und Gebotsschilder, was Avantgarde, was Zopf ist, gefallen sind, die zwei, lange Zeit unversöhnlichen Blöcke, konventionell gegen experimentell, sich mehr und mehr aufeinander zu bewegt haben und eine große Unverkrampftheit gegenüber Metrum, Reim, strengen Formen wie eine Lust an Regel und Regelbruch herrscht, lassen sich doch noch immer zwei Tendenzen oder Pole ausmachen, zwischen denen sich das vielfarbige Spektrum der Dichtung bewegt: eine eher dem Erzähl- als dem Materialcharakter zuneigende Dichtung, die auf die Wiederbelebung alter Formen zurückgreift, sich dem hohen Dichterton anlehnt, auch wenn sie ihn zuweilen ironisch modernistisch bricht, im Ganzen betrachtet aber etwas brav wirkt; und einer formengebärenden Dichtung mit einer frechen, manchmal rotzigen, aus Vergangenheitssättigung und Gegenwartshingabe geborenen Sprache, die überrascht, vor den Kopf stößt, verführt.
Nora Bossong, Jan Wagner und Marion Poschmann neigen zweifellos dem ersten der beiden Pole zu. Ihre Gedichte sind weniger in einem klassischen als einem biedermeierlichen Sinne schön, zu sehr vertrauen sie darauf, dass Schönheit entsteht, indem man schöne Wörter aneinanderreiht, gebrochen durch eine Pointe hier und da. Das beginnt dann schon bald zu säuseln, weil zu wenig quersteht, blockiert, den Lesefluss, Zuhörfluss aufhält, schmirgelt, durchlöchert. Es irritiert, wenn Bossong, deren Gedichte gern in fragil-weichem Licht zittern, eine Vorliebe für irisierende Töne hat, diese Töne doch immer ähnlich schwebend hält, gleich, ob sie über drei verblühte Rosen schreibt, über drei tote Wachteln auf einem niederländischen Stillleben – oder den Ort, an dem Mussolinis Leichnam und der seiner Geliebten Claretta Petacci, kopfunter an den Träger einer Tankstelle gebunden, geschändet wurden.
Duce
Ins Klirren der Kirchen, Klingeln der Trams
schaukelt der Körper vom Dach einer Tanke,
plustert sich auf in der Hitze, ein stinkendes Pendel.
Wir stehen dabei, Jahrzehnte zu spät, zeitlich verzogen
unser Blick zur Traufe, und jetzt landen Möwen
auf dem balzheißen Bau, ein Gurren, ein Flattern.
Der Körper kopfüber umtänzelt die Zwergin,
zwei salzweiße Leichen, der Geruch von Benzin.
Drei Kugeln kehlig, vier in der Schulter,
ferner sind Lenden und Arm ruiniert,
ein Sieb, eine Siebesfeier, die wir beäugen,
den letzten Ball der beiden Bälger
und wir, zwei dahergelaufene Zeugen,
wissen wir denn, was Liebe war.
Das Gedicht, das Geschichte nur als Reservoir für nostalgische Sentimentalität benutzt, evoziert kaum mehr als eine Stimmung, deren konkreter Anlass im Grunde austauschbar ist – und hinterlässt, wie der ganze Band (»Sommer vor den Mauern«, Hanser 2011), einen allzu abendlichtweichgezeichneten Eindruck.
Jan Wagner, inzwischen mit vier Lyrikbänden präsent, ist zupackender und konturenreicher. Aber auch bei ihm findet sich ein ungebrochenes Vertrauen in alte Formen und ein Ton, der mehr an C. F. Meyer erinnert als an einen Dichter des 21. Jahrhunderts.
chamäleon
älter als der bischofsstab,
den es hinter sich herzieht, die krümme
des schwanzes. (...)
die augenkuppeln, mit schuppen
gepanzert, eine festung, hinter der
nur die pupille sich bewegt, ein nervöses
flackern hinter der schießscharte (...)
In der geschliffenen Anwendung erprobter Mittel hat sich Wagner von Beginn an als begabt erwiesen, auch die »wir«-Mode der Aufbruchsjahre hat er mitgemacht, nur wirkt seine Lyrik, die die eigene Historizität kaum reflektiert, angestaubt und brav. Trotz virtuos gesetzter Endreime und swingendem Metrum ist er letztlich ein der narrativen Deskription huldigender Prosaiker – was fehlt, ist der Irritation auslösende Schwindel, ein Aussparung, die nicht leer ist, sondern eine Spannung herstellt zwischen zwei Elementen, die den Leser ins Gedicht zieht, als Mitbauenden, nicht ihn draußen stehen lässt als bloß zur Bewunderung angehaltenen Betrachter. Schönheit, will sie ergreifen, darf nicht Wiederholung eines Effekts, darf nicht intendiert sein, sondern muss sich im Prozess der Rezeption immer erst herstellen, nur so kann sie berühren, verwandeln. Die Perfektionierung des Bekannten macht aus Gedichten Gebrauchsgegenstände, im schlimmsten Fall Parodien.
Auch Marion Poschmann zieht es zu strengen Formen, symmetrischem Strophenbau, festem Metrum; aber ihre lyrische Welt ist komplexer gebaut. Wenn sie mit Wagner auch einiges, wie den narrativen, deskriptiven Trieb gemeinsam hat, ihre Sprache ist weniger gewiss, linear strukturiert, gibt den Assoziationen mehr Raum. Erkauft wird die größere Offenheit und Durchlässigkeit jedoch durch eine Vagheit des Stils, die zwar beabsichtigt sein mag (ihr letzter Gedichtband, »Geistersehen«, Suhrkamp 2010, variiert nicht nur thematisch Unschärfen, Vexierbilder, Erinnerungen), oft aber unsouverän wirkt. Geradezu inflationär ist der Gebrauch der Vergleichspartikel (»etwas wie«, »wie«), das Fehlen von Verben und Artikeln oder eines spezifizierenden Attributs selten befriedigend (»uns blieben Spuren von Bewegung«). Verstärkt wird der Eindruck durch das großzügige Ausstreuen von Unbestimmtheits-Adverbien (»beinahe«, »fast«, »wohl«, »irgendwie«), die zwar das Zittrig-Verwischte flüchtiger Gefühle, Erinnerungen, Gedanken hervorrufen, jedoch nicht überzeugen, da die Mittel allzu sehr in Ohr und Auge fallen. »herbstlich und kühl ist es / herbstlich und kühl«, beginnt das Gedicht »Erinnerungen an was«, eine Leerzeile folgt, und mehr brauchte es nicht: hier beginnt der Aufflug. Das Sinnlich-Konkrete, Gegenwärtige hat Verführungskraft. Stark ist Poschmann da, wo sie die strenge Form, die sie zu oft mit überflüssigen Partikeln füllt, aufgibt, stattdessen einem Bild vertraut und diesem folgt:
Rheinisches Schiefergebirge
ich hatte versehentlich Teflon
zerkratzt, mit Metallbesteck
Umrißlinien prähistorischer Tiere
in eine unserer Pfannen gezogen
(...)
ins Spülwasser tropften
Mammute, Auerochsen, trafen auf die
verzerrte Spiegelung von Riesenhirschen
ich blieb ein Schwamm,
der uns bis hinter das Licht führte
triefend vor Müdigkeit
sie trocknete ab, faltete Ewigkeiten
auf Handtuchformat
Es mag auf den ersten Blick seltsam anmuten, eine ganze Phalanx von Dichtern, die den bereits eingangs erwähnten elitär-arroganten, urbanistischen Wir-Kult pflegen und von denen hier nur Tom Schulz, Daniel Falb, Alexander Gumz als Protagonisten genannt sein sollen, den Traditionalisten anzureihen. Ihre Verse, prosanah, emotionsscheu, lapidar, sind eine Sammlung von Oberflächenbeobachtungen, kühle parataktische Narrationen in räumlicher wie zeitlicher Unbestimmtheit (»da gab es«, »oder ein anderer ort«, »einmal«, »dann«), mit großer Vorliebe für neutralisierende Plurale (»foyers oder lobbys«, »knorrige damen«, »männer«), Passivkonstruktionen und neugefügte Komposita. Die Syntax wird nur wenig variiert, ebenso wie das Metrum – so entsteht ein dünner stakkatohafter Sound, der das lyrische Sentiment trockenlegt.
Handwerklich ist das so gut gemacht, dass sich die Wiederholung eine Zeit als Innovation ausgeben kann. Auf die Dauer aber wirken diese Gedichte, die zu viele nur behauptete Gewissheiten aneinanderreihen, wie dekorative Fertigkost. In ihr drückt sich, wenn auch in zeitgeistigem Vokabular, letztlich ein ähnlicher Konservatismus aus wie bei den Traditionalisten, nur nüchterner, freudloser. Er spiegelt das Lebensgefühl einer idiosynkratischen Generation, die ihre Erfahrungen vorrangig medial vermittelt macht, selbst die Ahnung, das Echo eines Gefühls als Bedrohung wahrnimmt und sogleich rationalisierend auf Distanz geht. Dass die Texte zweidimensional bleiben wie die Welt, die sie verhandeln, folgt aus der Logik ihrer mimetischen Poetologie. In ihr spiegelt sich eine Fin-de-Siècle-Existenz, geführt als Lebenssimulation, mit Ehrgeiz, aber ohne Enthusiasmus. Sie bildet ein homogenes Cluster aus Minimalbewegungen, an das nur noch das Ähnliche andocken kann.
Blumentapeten, Metamorphosen und die Imago des Gedichts (Winkler, Popp)
Ron Winkler, der mit den Lebensformpoeten auf den ersten Blick manches gemeinsam hat – auch er huldigt dem lyrischen Wir, liebt die parataktische Syntax, ist geradezu neologismentrunken und hat eine Schwäche für Unbestimmtheiten –, hält seine Synapsenenden dagegen neugierig ins Offene. An bloßer mimetischer Verdopplung abgepackter Wirklichkeitsfasern ist er nicht interessiert. Und unterliegt nicht dem Irrtum, Dichtung erschöpfe sich in der Verlabelung medial gefilterter Wirklichkeit, er erfindet sich seine eigene, faltet die Sprache auf, hinein in einen Möglichkeitsraum, der nur noch seinem eigenen Referenzsystem gehorcht, das ihn mit seiner unerschöpflichen Potentialität ebenso zu überraschen vermag wie den Leser. Im zuletzt erschienenen Band, »Frenetische Stille« (Berlin Verlag 2010), hat Winkler den früheren Hang zu photoshopbunter Tapetenpoesie zwar nicht gänzlich abgestreift, die lyrische Immanenz in Richtung überschießender poetischer Welterfindung aber glücklich verlassen. Die Texte durchscheint eine Imago des Gedichts, ein Ideal der Gattung, erschaffen aus einem Eigensinn, der sich die Mittel zubereitet, nicht importiert. Den Leser ergreift da eine ästhetische Lust, die ihn nicht mehr vorwärtstreibt, einer Pointe zu, sondern verweilen lässt im Genuss des poetischen Überschusses.
Fächer: Von den Jahren der Reise an einem einzigen Tag
(...)
wir saßen da, in dieser massiv ätherischen Landschaft
aus Augenaufschlägen, saßen da und saßen zugleich: in unseren Träumen.
als noch nicht
begonnene Bräutigame. und fühlten uns
angesprochen bei den Durchsagen auf ihrer Suche nach empfänglichen Ichs.
es war
unsere Suche. und Suche war unser Empfang.
ich konnte das Klima mittlerweise aus deinen Gesten
lesen. und dass sich neben uns nicht nur Punkpraktikanten befanden
mit beruhigend hündischen Tieren,
sondern auch Lichtschaffende und Lichtdistributoren, versunken
in die Pfauenflora,
die als kinetischer Horizont an uns vorüberzog,
während die Stadt im Norden zu einer Stadt im Süden wurde,
geworden war.
(...)
Ähnlich lebendig wie Winkler, wenn auch von anderem Temperament, ist Steffen Popp. Ein schwermütiger Metaphysiker, ohne Scheu, seine Sensibilität zu zeigen, hier und da ein wenig pathosverliebt. Schon im ersten Band (»Wie Alpen«, Kookbooks 2004) hatte er seinen ganz eigenen Ton, der, ohne Vorabgewissheit und doch auf die eigenen sanften Kräfte vertrauend, sich einer vorwärt tastenden, mäandernder Bewegung überlässt, gleichsam über ihnen schwebend die Entstehung der Verse begleitet: »am Talgrund zog unter dem Eis / das Wasser meerwärts, in seiner Eigenzeit / nahm Steine mit, das Licht, ich / blieb, für mich / ein verwickeltes Umspannwerk –«, heißt es in »Winter, Kunst der Entfernung«. Diese Bereitwilligkeit, das Gedicht seine eigene organische Form finden zu lassen, ist im fertigen Text immer noch spürbar, verleiht ihm seine Transparenz und die Fähigkeit, den Leser in einen leichten klaren Schwindel zu versetzen, eine behutsame Levitation, die es erlaubt, die Ordnung gerade so weit zu verlassen, dass sie sich als formende und formbare zu erkennen gibt – und damit den »Geist der ewig lebenden ungeschriebenen Wildniß« (Hölderlin). Popp ist ein Metamorphotiker, ein naturforschender Verwandlungskünstler, Kosmossehnsüchtiger (der zweite Band, »Kolonie Zur Sonne«, Kookbooks 2008, zeigt es klar) – nur in den abschließenden anderthalb Versen erdet er sich zu oft, als hätte er Angst, zu entschweben. Man möchte sie ihm gern wegstreichen, diese Enden, die den Gedichten den Atem abschneiden und sie der schönen Freiheit berauben, zu sich selbst zurückzukehren.
O elefantischer Pan im Porzellantrakt der Musen
hinter den Schleiern suchst du Gesang, übst dich
in Gedanken: »Wir sind
ein Gespräch« sagst du, »Wir sind
Elefanten«
und bist ganz allein mit diesen Sätzen
einsamer als Dialoge, Dickhäuter
einsamer als die Elektrogeräte des Weltalls
stromsparende Lampen, Wärmepumpen
verwahrlost und hungrig nach Liebe kommen sie
langsam heran aus dem unendlichen Dunkel
an deiner Raumkapsel, ihren geheimen Sprossen
an deinen klugen Händen und Knien
deinen schlafenden Füßen, geträumten Flügeln
reiben sie ihe Felle aus Chrom und Kunststoff.
Die angelernte Hilflosigkeit der Gegenstände
Unmöglichkeit einer Berührung
das Lied, unter seiner Nachtmütze aus Sternen
bewegt es den einsamen Boiler, den irrenden Ventilator
den irrendes Auge
auch
in eine Nestgemeinschaft ohne Strom
ohne Gedanken
nur gravitierende Körper, ihre beinahe
staatenbildende Panik vor dem Winter
Anarchie, gebändigtes Chaos, Erleuchtung (Cotten, Rinck, Utler)
Wie auch immer man die Anziehung, die ein Kunstwerk auf uns ausübt, nennen will, Reibung, ästhetischen Eigensinn, Geheimnis, erfahren wird er als eine Verrückung, eine Erschütterung unserer denkenden und fühlenden Beziehungen zur Welt. Die Qualität eines Gedichts (wie jedes Kunstwerks) bestimmt sich vor allem daraus: Ob es diese Erschütterung immer wieder neu herzustellen, sie zu verwandeln, zu steigern vermag, ob es, trotz der zunehmenden Vertrautheit im Detail, immer von neuem überrascht und irritiert. Die Schwierigkeit für die Literatur, die Lyrik insbesondere, besteht darin, dass diese Erfahrung in einem Medium gemacht wird, das sinnliche (Laut, Prosodie, Rhythmus) und sinnhafte Elemente vereint, das Klang- und Bedeutungsträger ist.
Das lyrische Potential auszuschöpfen, gelingt nur, wenn das Gedicht diesen Doppelcharakter der Sprache zum Vorschein bringt, und zwar auf beiden Ebenen: klanglich und thematisch. Damit einher geht das Aufscheinen seines Gemachtseins. Nur wenn dieses in seiner Struktur, die, wenn es gelungen ist, gleichzeitig eine gedankliche wie formale ist, aufscheint, kommt es nicht zu isolierter Betrachtung von Inhalt oder Form, sondern das Gedicht als Gedicht tritt in seiner Essenz hervor, transzendiert sich selbst, ist ein Integral, vollkommen offen und gleichzeitig unverfügbar. Wie bei der Kleinschen Flasche Innen und Außen ununterscheidbar sind, durchdringt es sich selbst, aber nicht als etwas Fertiges, als Produkt, sondern als Prozess. Der Ort, von dem aus sich diese Bewegung vollzieht, der Schreibort, Artikulationsort, ist dabei ebenso anwesend wie der des Hörenden, Lesenden. Sie befinden sich in einem Raum, einer Zeit: im hochkonzentrierten, gespannten Präsens des Textes, der seine Grenzen mit jeder Begegnung weiter ins Unendliche verschiebt.
Auf je eigene Weise haben Ann Cotten, Monika Rinck und Anja Utler einen solchen durch und durch präsentischen lyrischen Raum geschaffen. Der von Cotten ist wild, anarchisch, überschießend, verspielt. Ihre Gedichte sind nicht Resultate, sondern Versuche, frühromantischer Ästhetik folgend, die immer das Unfertige dem Fertigen, das Fragment dem Werk, die Heterogenität der Homogenität vorgezogen hat. Dass die zunächst empfundene Unordnung nicht ästhetischem Scheitern geschuldet, sondern vor allem Ausdruck der Überforderung des Rezipienten ist, zeigt sich nicht nur an Cottens erstem Band, den 2007 erschienenen »Fremdwörterbuchsonetten« (Suhrkamp), die einer Neuerfindung der Gattung in Einzelgedicht wie Zyklus (Sonettenkranz) gleichkommen, sondern vor allem in den Prosa und Lyrik kombinierenden »Florida-Räumen« (Suhrkamp 2010). Erst durch wiederholte Lektüren bilden sich hier allmählich die Wahrnehmungsstrukturen heraus, die in der scheinbaren Unordnung den hochkomplexen, alles andere als Willkür und Zufall gehorchenden Bau zu erkennen vermögen. »Wenn man (...) nicht erkennt, wie ein Werk sich wiederholt, dann ist dieses Werk beinahe buchstäblich unkenntlich und deshalb zugleich unverständlich. Es ist das Erkennen der Wiederholung, das ein Werk verständlich macht«, heißt es bei Susan Sontag. Die allmähliche Entdeckung der Muster, der Verschränkung von Mikro- und Makrostruktur aber verschaffen die Lust, die Ausdruck der Verwandtschaft von Lesen und Schreiben als schöpferischem Erleben ist.
Diese Lust findet man auch bei Monika Rinck – und in noch gesteigertem Maß. Was eine Vielzahl von Lyrikern im Einzelnen versucht, formal, tonal, thematisch, in ihren jüngst erschienenen »Honigprotokollen« (Kookbooks 2012) ist all das zur Synthese geführt. Verblüffend und beglückend, wie sie in den Gedichten Mehrstimmigkeit erzeugt. Jedes Wort, jeder Vers, jeder Reim, jeder Klang (nirgendwo finden sich überraschendere, gelungenere Assonanzen, Konsonanzen, Alliterationen als bei Rinck, wie auch ihre Verbneologismen auf ganz neue Pfade verführen) ist mit dem ihm Benachbarten verknüpft, öffnet einen Sprachraum, in dem alles allem begegnet: die Tradition der Zukunft, der Ernst dem Humor, die Romantik der Klassik der Moderne, die Naivität der Analyse der Reflexion dem Hohn, die Poesie der Prosa der Poesie. So lange ein solcher Text nicht in der Welt ist, ist er nicht vorstellbar, vorstellbar nicht mal, dass es ihn geben könnte. Ein klassisches Werk, in dem die gesamte abendländische Dichtungstradition mitschwingt, in die Texte hinein-, aus ihnen herauswachsend, was nichts anderes heißt als: ihre organische Struktur bildend.
»Man macht Gedichte aus Gegenständen, zu denen / man zärtlich für die Zeit der eigenen Verschiebung«, schreibt Cotten in den »Florida-Räumen«. Dichten heißt aufmerksam sein für das, was sich ereignet. Und zwar nicht als teilnehmender Beobachter, sondern als Liebender. Die Liebe aber folgt keinen Regeln, sondern gibt sich eigene. Und der Dichter, der dem organischen Wachstum des schöpferischen Prozesses als Liebender gegenübertritt, ebenso. Er wird dann nicht die Sprache benutzen für das Gedicht, sondern die Sprache selbst zur Sprache bringen.
Anja Utler ist weder an Mimesis noch Fiktion interessiert, sie braucht keine Vergleiche, keine Metaphern, sie überlässt sich in ihrer Dichtung ganz den Klangbewegungen. Es »geschieht« nichts – außer in der Sprache. Der Leser aber erfährt gerade dadurch, was Sprache ist: Speicher einer Körperlichkeit, einer Gewalt, die sich in ihrem Gebrauch offenbart. Die, wie in »marsyas, umkreist« oder »für daphne: geklagt« (»münden – entzüngeln«, Edition Korrespondenzen 2004), sich ihm, lesend, einzeichnet als Körpermarter, als grausame Verwandlung. Oder als das Unterholz durchpirschender Gang – der sich öffnet in eine Erleuchtung:
dann: auffalten, alles, dem hals und dem
dickicht ins: holz dringen, weiter, sich
abzweigen: finger, vom brustkorb, und
bloß gelegt, ordnen, die adern sich:
neu bahnen, werden zu: ausläufern
– folgen – sie zeigen auf: röhricht auf:
fasrig auf: ins gestrüpp münden – sickern –
den rippen nach, ästeln, dazwischen
– inmitten – erzeugt sich: der teich
Utlers Gedicht erzeugt, wovon es spricht. Wir müssen uns nur für seine sprachliche Bewegung öffnen, das heißt seinem Klang, seiner syntaktischen Struktur, der Offenheit seiner Form, der Polyvalenz und Schönheit seiner Sprache sowie den Assoziationen, die sie in uns auslöst, überlassen, ihm vertrauen und uns den eigenen Emotionen anvertrauen: Freude, Verwirrung, Begeisterung, Erschauern, Furcht. Es versetzt uns zurück an den Ursprung aller Dichtung, ihr Verwurzeltsein in Kult, Beschwörung, Magie. Macht aus uns, seinen Leserinnen und Lesern, exzentrischen Beobachtern, Erkunder von Relationen, Schwellenbewohner, durchlässig für neue Erfahrungen.
fixpoetry, Mai 2013