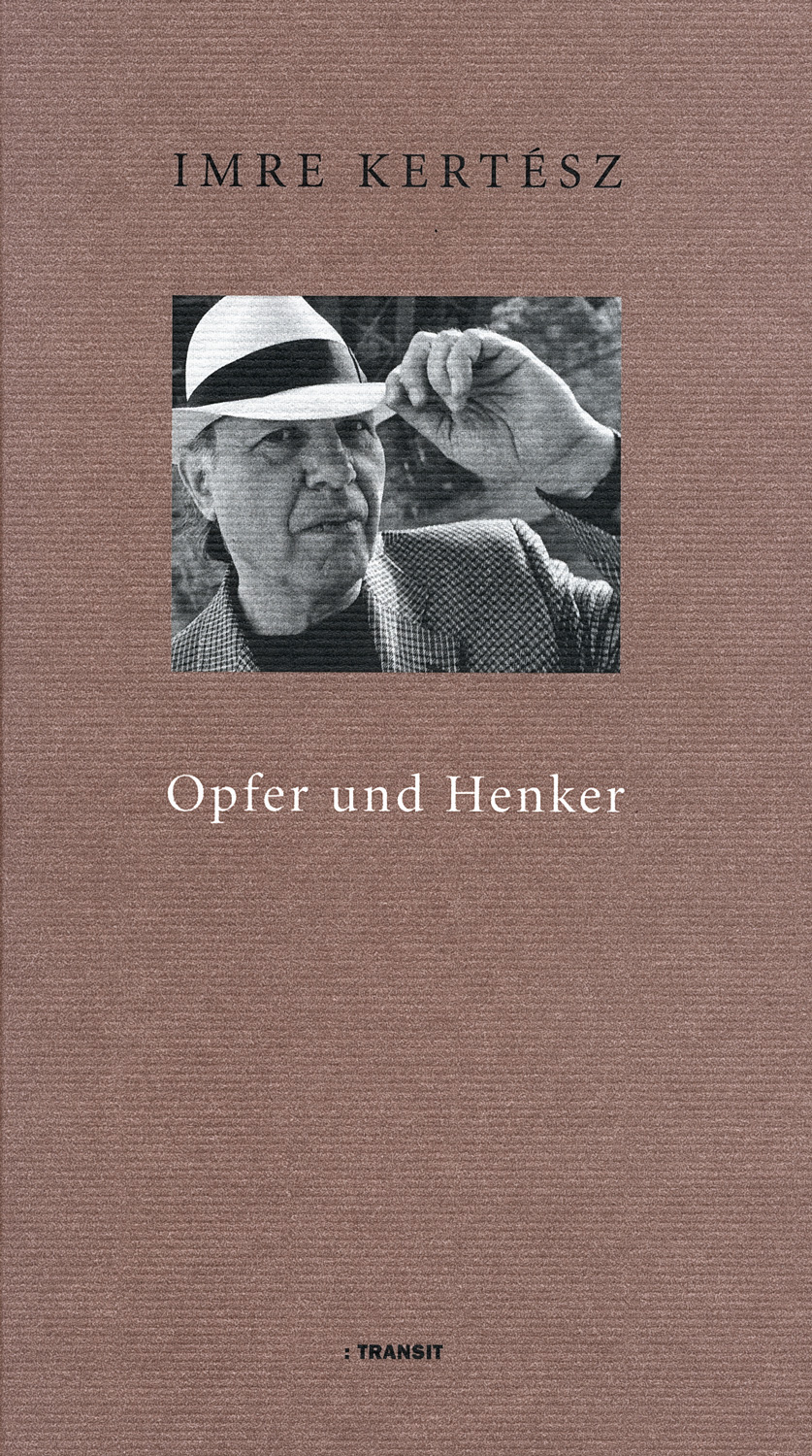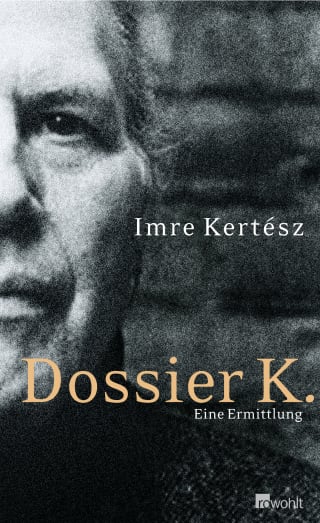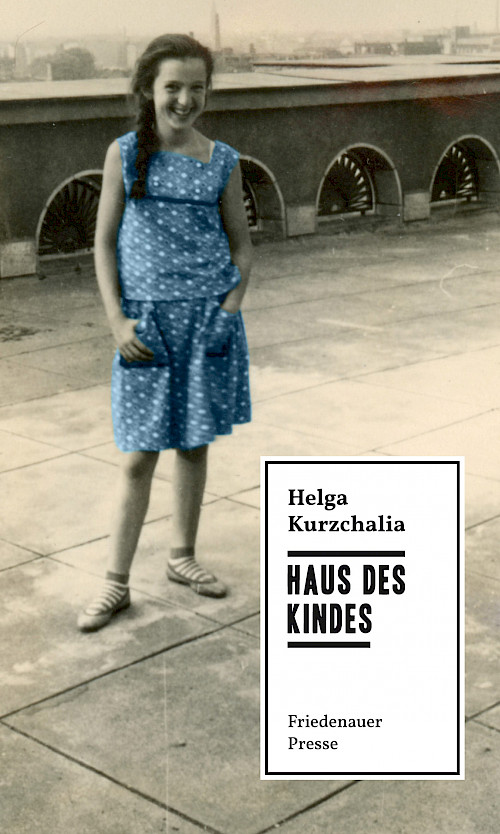Der beschämende Prozess des Überlebens
Im Transit Verlag ist eine Anthologie mit Texten von Imre Kertész erschienen
»Opfer und Henker« ist der soeben erschienene jüngste Band von Imre Kertész betitelt, der fünf kürzere Texte des Nobelpreisträgers aus fünf Jahrzehnten versammelt. Diese kleine Anthologie ist dem 1981 gegründeten Transit-Verlag zu verdanken, der für seine Leser immer wieder literarische Fundstücke und Überraschungen bereithält. So erschien 2006 unter dem Titel »Kaum beweisbare Ähnlichkeiten« der Briefwechsel zwischen Uwe Johnson und Walter Kempowski – in gleicher ansprechender Aufmachung: Hardcover, Fadenheftung, edles Papier, dazu versehen mit Faksimiles und Fotos.
Die Texte des Bandes »Opfer und Henker«, darunter zwei der frühesten literarischen Arbeiten von Kertész, in denen er sich, wie in seinem Werk generell, mit den Themen Schuld und Unschuld, Fiktion und Wirklichkeit, Freiheit und Unterwerfung auseinandersetzt, sind zwar alle bereits an anderem Ort – so in der Imre Kertész gewidmeten Ausgabe der Zeitschrift »DU“ (Nr. 5, Juni 2005) – erschienen. In dieser Zusammenstellung aber gewinnen sie noch einmal ein anderes Ansehen. Und es scheint einem, als ob in ihnen auch die innere Entwicklung des Autors deutlich würde – beginnend mit archaischer Bitternis gehen sie in einen Sarkasmus über, der an Zynismus grenzt, und münden schließlich in eine den Schmerz überwindende heitere Luzidität.
Den Auftakt macht »Erdenbürger und Pilger«, eine Paraphrase der Kain-und-Abel-Geschichte und zugleich eine Parabel darüber, wie der Hass in die Welt kommt – zwischen Brüdern und, ganz allgemein, zwischen Menschen. »Er ist da, und weil er da ist, ist es für mich eng geworden«, heißt es gleich zu Beginn. Der Ältere spricht dem Jüngeren vom Tage seiner Geburt an die Existenzberechtigung ab, weil sie ihn, in ihrer Andersartigkeit, verunsichert und einschränkt: »Und alles, was er sah, reizte ihn. Der Bruder machte es anders als er. Nicht schlecht, aber anders. Das reizte ihn.«
Es ist also ein Hass, der durch Neid und Missgunst hervorgerufen wird und den eine aus dem eigenen Minderwertigkeitsgefühl gespeiste Arroganz begleitet. Diese ruft bei dem anderen Schuldgefühle hervor, unbegründete, und doch im Hass des Gegenübers begründete. Er redet sie ihm ein, bringt ihn dazu, sie zu verinnerlichen, allein dadurch, dass er ihn beschuldigt.
Kertész macht aber aus dem Text noch mehr als nur eine am Bibeltext entlang erzählte Ausformulierung der Kain-und-Abel-Geschichte. Seine Parabel wächst ihm gewissermaßen hinüber ins zwanzigste Jahrhundert und nimmt das jüngste Kapitel der deutsch-jüdischen Geschichte in den Blick. Indem Kertész die Beschreibung von Aussehen und Verhalten der beiden Brüder der nazistischen Rassen-Typologie folgend anlegt – Kain erhält »nordisch-arische« Züge, Abel »semitische« –, verwandelt sich die »alte Geschichte« in eine aktuelle, soeben geschehene. Sie erzählt von dem einen Mord – und zugleich vom millionenfachen Mord an den Juden durch die Deutschen.
Das wird insbesondere im zweiten Teil der Parabel deutlich, in dem Kertész die Folgen, die der Brudermord für Kain hat, auserzählt. Und diese sind bitter, nicht so sehr für Kain, sondern für den Leser. Muss dieser doch sehen, wie der Mörder zwar eine Zeit unstet lebt, dann aber heiratet er, zeugt Kinder, baut ein Haus, dann mehrere, schließlich eine ganze Stadt. Seine Geschäfte dehnen sich aus, er genießt Ansehen und gelangt zu Wohlstand. Und das ihm von Gott auf die Stirn gesetzte Mal »gereichte ihm nicht zum Schaden, übte auf Fremde vielmehr Anziehungskraft aus«.
Wer denkt da nicht an die (West-)Deutschen, die an ihren Nachbarn zu Mördern geworden waren, und an ihr Nachkriegswirtschaftswunder, in dem sie ihre Verbrechen vergaßen. Nur ab und an, wenn »seine Arbeit es zuließ, sann Kain mitunter über die Vergangenheit nach. Beim Gedanken an den Bruder überkam ihn ein leichtes Zittern, als ferne Erinnerung an die alte Lust; und wenn sein Gedächtnis den Herrn aufrief, legte er sorgsam die Hand vor den Mund und lachte sich still ins Fäustchen.«
Auch der zweite Text des Bandes, »Ich, der Henker«, ist bitter – es handelt sich um ein Erzählfragment, von Kertész Ende der fünfziger Jahre geschrieben, das fast dreißig Jahre später Eingang in seinen Roman »Fiasko« fand. Eine im Ton erbauliche, salbungsvolle, dennoch von mancher harten Erkenntnis nicht freie Einleitung zu einer Erinnerungs- und Rechtfertigungsschrift eines »Henkers« (Massenmörders, Kriegsverbrechers), die Kertész so anlegt, dass sie ähnliche, jedoch ernstgemeinte Memoiren von Nazigrößen, wie etwa Albert Speer, als an Infamie kaum zu überbietende Machwerke entlarvt, indem sie ihren Ton nur um ein weniges übertreibt.
Der sich selbst als Henker Bezeichnende ist ein intelligenter, ein scham- und skrupellos intelligenter Kain, ein Wortjonglierer, Vulgärpsychologe, der alles solange zurechtbiegt, bis er, ohne sie zu leugnen noch zu bekennen, aus seiner Schuld sein Verdienst, aus seinem Bekenntnis seine Verteidigung gemacht hat. Und der sich für seine Taten noch feiern lassen will – da er nur »den verborgenen Willen« seiner »Umwelt« ausgeführt habe.
Er ist gewissermaßen der Held des Verbrechens und des Untergangs, der sich gefunden hat, der sich finden musste – und der jetzt die Schuld schultert, weil sein Rücken, wie er meint, im Gegensatz zu dem der anderen breit genug ist, sie zu tragen. Der sie den anderen »abnimmt«, obwohl sie sie nicht begangen haben – und (möglicherweise, wer will das wissen?) nicht begangen hätten, hätte er’s nicht getan. Aber er stellt es so hin, als hätte er ihnen einen Dienst erwiesen, sie vor dem Schuldig-Werden gerettet, als hätte es ein stillschweigendes Übereinkommen zwischen ihnen gegeben – als sei die Schuld keine subjektive, sondern eine kollektive.
Im dritten Text, Ende der siebziger Jahre entstanden, verarbeitet Kertész autobiographische Erlebnisse aus der Zeit, in der er als Anfang Zwanzigjähriger den Versuch unternahm, als Journalist im zunehmend stalinistischer werdenden Ungarn sein Brot zu verdienen – jedoch die verlangten ideologischen Anpassungsleistungen nicht zu vollbringen vermochte.
Dem Ich-Erzähler der kurzen Erzählung gelingt zunächst noch das Kunststück, durch Pünktlichkeit und Unauffälligkeit eine Art Nicht-Existenz, die auf der Nicht-Beachtung beziehungsweise dem Übersehen-Werden durch die anderen beruht, zu führen. An einem Morgen jedoch, auf dem Heimweg nach einer langen Nacht, kommt er an einer Parkbank vorüber. Auf ihr sitzt ein ihm bekannter Bar-Pianist, der ihn Platz zu nehmen bittet und ihn bis zum Morgengrauen durch seine Geschichten wachzuhalten und vom Heimgehen abzuhalten weiß. Die Zeit bis zur Dämmerung nämlich ist die »gefährliche Zeit«, in diesen Stunden werden die vom System zu Feinden erklärten Menschen aus ihren Betten geholt, auf Lastwagen verfrachtet und abtransportiert.
Der Pianist geht dann nach Hause, um zu schlafen. Der Ich-Erzähler aber, durch dieses Erlebnis plötzlich hellwach, mit allen Sinnen aus seiner Erstarrung erweckt, hat seine »Bank«, auf der er bis jetzt sicher saß, verloren – und er weiß es, aber es ist ihm Grund zu Freude und Erleichterung, ist er doch sich selbst zurückgeschenkt. Er meldet sich in der Redaktion seines systemkonformen Blattes krank – und es sieht ganz danach aus, dass er nie wieder einen Fuß dorthin setzen wird.
1998 fragte das »Zeit“-Magazin bei Kertész an, ob und wie er sein Verhältnis zu Budapest, seiner Heimatstadt, bestimmen könne, und er antwortete mit einem »Bekenntnis“, das eigentlich jedoch ein Nicht-Bekenntnis zu dieser Stadt war, denn er schrieb davon, dass er sich dort wie ein »Auswanderer« fühle, »der es zwar seit Jahrzehnten versäumt, sich seine Reisedokumente zu beschaffen, sich jedoch auch hütet, in dieser Stadt tiefer Wurzeln zu schlagen, denn der Briefträger könnte ja jederzeit mit den Papieren an der Tür stehen«.
Obwohl ihn also mit Budapest nicht mehr als die Zufälligkeit des Geburtsortes zu verbinden scheint, dem er gern den Rücken zukehren würde, hängt er doch an dieser Stadt, vor allem an ihrer Landschaft, den Budaer Bergen und der großzügigen Weite des Pester Straßengezweigs. Und dennoch muss er feststellen, dass die Stadt, je länger er in ihr wohnt, ihm entgleitet, dass sie ihm fremd geworden ist, als wäre er noch nie dort gewesen, da seine Erinnerungen sich nicht mehr mit ihrem neuen Erscheinungsbild in Übereinstimmung bringen lassen.
Aber die Entfremdung begann schon früh. Bereits in der Kindheit baute sich eine Distanz auf, hervorgerufen durch die Erfahrung, dass er in Budapests Mauern nicht willkommen war. Es ist der Ort, an dem ihm die Geschichte entgegentrat, unheilvoll, lebensbedrohlich, und sie hat früh das Einvernehmen, die unhinterfragte Übereinkunft mit der Stadt zerstört.
Und dennoch blieb Kertész ihr treu. Nach der Rückkehr aus dem Konzentrationslager, 1945, war es noch eine eher zufällige Entscheidung; 1956, nach der Niederschlagung des Aufstands aber, hatte er bereits zu schreiben begonnen und wusste: er musste bleiben, der Sprache wegen. Und er hat es nicht bereut, geblieben zu sein. Denn so konnte er »an einer merkwürdigen Lebensperiode Budapests teilhaben, seinem grauen Verharren in der Wüste aussichtsloser Alltage, die man hier Sozialismus nannte«.
1989 aber löste sich die Notwendigkeit, die Stadt als Erkenntnisquelle, nicht zuletzt über sich selbst, zu nutzen, und Kertész notierte: »Man kann die Freiheit nicht am selben Ort kosten, wo man die Knechtschaft erduldet hat.« Und dennoch blieb er in Budapest, obwohl er spürte, dass seine Anwesenheit in geistiger Hinsicht nicht mehr gerechtfertigt war, dass die Veränderungen der Stadt ihn weder in seinem existentiellen Wissen bereicherten noch seine moralische Widerstandsfähigkeit auf die Probe stellten. So war sein Bleiben »nicht das Ergebnis neuerlicher Wahl«, sondern das »einer versäumten Wahl«. Und er war immer noch der potentielle Auswanderer, der mit der Mahnung eines gepackten Koffers lebt.
Dann aber kam Berlin. Zunächst eine Arbeitswohnung, dann ein einjähriges Stipendium am Wissenschaftskolleg – und Kertész blieb in der Stadt hängen. Er kannte sie, jedenfalls den Ostteil, von früheren Besuchen, und das geteilte Berlin war ihm Symbol des Kalten Krieges und der eigenen Knechtschaft. Bis heute ein Ort, der seine schreckliche Vergangenheit nicht verhehlt.
Für Kertész gibt es keine zweite Stadt in Europa, »in der man die Gegenwart und den Weg, der zu ihr geführt hat, so intensiv wahrnehmen kann“. Dies und ihre Offenheit und Neugier machen sie für ihn zu einer der wichtigsten Hauptstädte Europas, und, was für ihn noch bedeutsamer ist, als traditionsreiche Mittlerin zwischen Ost und West, Nord und Süd gibt sie ihm das Gefühl, mit seinen Büchern in ihrem geistigen Leben einen Platz gefunden zu haben. Berlin ist für Kertész, für den Begriffe wie »daheim«, »zu Hause«, »Heimatland« obsolet geworden sind, zu dem geworden, was er wirklich zum Leben braucht: ein bewohnbarer Ort.
Imre Kertész: »Opfer und Henker«. Aus dem Ungarischen von Christian Polzin, Ilma Rakusa, Agnes Relle und Kristin Schwamm. Mit einem Foto und einem Faksimile. Transit Verlag, Berlin 2007. 86 Seiten, 14,80 Euro
Die Berliner Literaturkritik, 26. Juli 2007