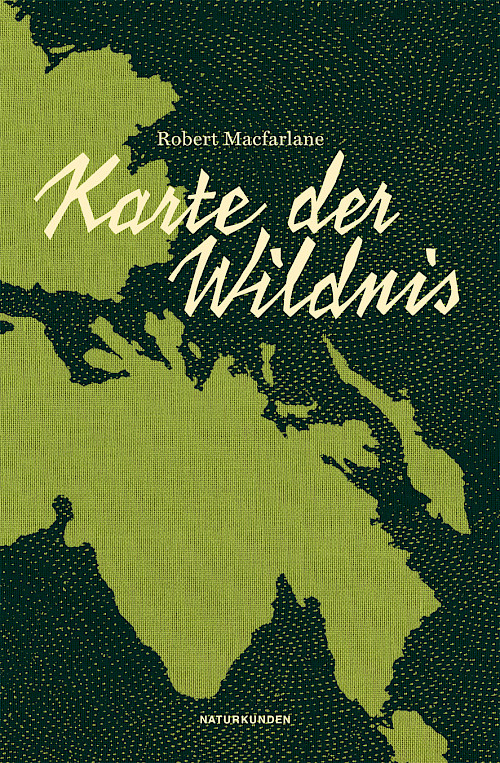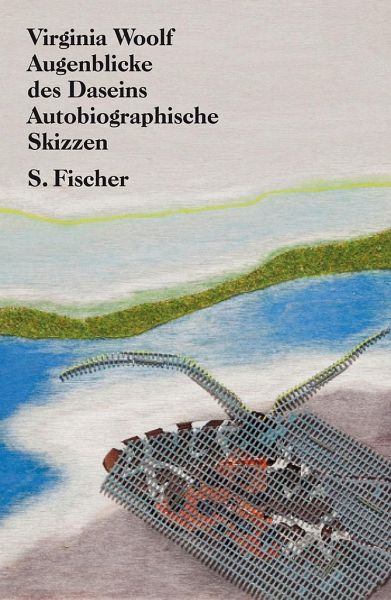Gegen das Vergessen
György Dragomán erzählt in seinem Roman »Der Scheiterhaufen« vom Ende des rumänischen Kommunismus und den Schwierigkeiten des Neubeginns
Eine Stadt in Rumänien, kurz nach dem Sturz des kommunistischen Regimes und dem Tod des Diktators Ceausescu. Emma lebt als Vollwaise in einem Internat, ihre Eltern sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Eines Tages wird sie ins Direktorinnenzimmer gerufen. Dort sitzt eine alte Frau, die behauptet, ihre Großmutter zu sein. Sie nimmt Emma mit. Mit in die Stadt, in der sie mit dem Großvater und der Mutter gelebt hat und in der Emma noch nie zuvor gewesen ist, weil ihre Eltern dort weggingen, bevor sie geboren wurde. Danach hatten sie jeden Kontakt zu den Großeltern abgebrochen.
Warum? Das ist eine der vielen Fragen, die Emma an die Vergangenheit hat. Aber nicht viele Fragen darf man direkt stellen. Man muss warten können, bis die Erwachsenen, die Kinder von selbst zu erzählen beginnen. Bis die Dinge sich zeigen, irgendwo, in Schubläden, Holzschuppen, auf Dachböden zum Vorschein kommen. Man muss sie im Stillen für sich hin und her schieben, zusammensetzen, ein kompliziertes Puzzle, mit vielen Lücken, gezinkten Zähnen und Mündern. Und um die falschen Teile von den richtigen unterscheiden zu können, muss man genau registrieren, wie diese und jener in der Stadt sich verhalten, ob sie eine Schwäche oder ihre Position ausnutzen, sich auf die Seite der Stärkeren schlagen, lügen, stehlen, nachtreten, oder ob sie sich, auch wenn es für sie nichts zu gewinnen gibt, solidarisch zeigen, ob sie einem die Hand reichen, wenn man am Boden liegt, etwas schenken, was man sich sehnlichst wünscht, oder einfach mit einem irgendwo hingehen, einem etwas zeigen, das schön ist, groß.
Emma erfährt beides. Sie wird in der Schule von Lehrern und Klassenkameradinnen gequält, aber sie hat auch einen Zeichenlehrer, der ihr Mut macht, und Herrn Pali, bei dem sie Geländelauf trainiert. Er hat ihren Großvater, der mal die halbe Stadt privat in Erdkunde und Französisch und Geschichte unterrichtet hat, gekannt, er glaubt nicht, dass er, der nach dem Krieg verfolgt wurde, im Lager saß, ein Spitzel war. Und Emma hat Péter, einen Jungen, der ein paar Klassen über ihr ist und in sie verliebt. Der hat einen Falken abgerichtet und quält sich jetzt mit der Frage, ob der Falke, wenn er ihn fliegen lässt, zurückkommt, weil er zurückkommen will oder weil er nicht weiß, dass er auch etwas anderes tun könnte.
Dieselbe Frage stellt die Großmutter ihrer Enkelin. Ob sie bei ihr bleiben wolle. Nur dass Emma kein Falke ist. Deshalb ist es komplizierter. Sie kann darauf mit ja antworten und trotzdem nein meinen, sie kann bleiben, obwohl sie weggehen will, wie sie auch weggehen könnte, obwohl sie eigentlich lieber dabliebe. Menschen haben Stolz, haben Pflichtbewusstsein, sind neugierig, haben Geheimnisse, sie sind nicht einfach, zwischen Ja und Nein gibt es viele Nuancen, und eine Welt, die einen zwingt ja, ja und nein, nein zu sagen, ist keine schlichte, überschaubare Welt, sondern eine, die nicht wahrhaben will, dass es Ambivalenzen, Stimmungen, Widersprüche gibt. Es ist eine Welt, in der man gezwungen ist, zu lügen und zu quälen, in der man sich verstecken, in der man verraten und vielleicht sogar töten muss.
Dragomán verbindet in seinem Roman die Perspektive der Heranwachsenden, die ihre magische kindliche Welt erst halb verlassen hat, immer noch an Beschwörungsformeln, Zaubersprüche und die Wahrheit von Träumen glaubt, mit dem kühlen, genauen Blick, den Kinder so oft in der Literatur und im Film haben, diesen unbestechlichen Blick, der sie gegen alle Verbote und Tabus das Richtige tun und unerschrocken nach der Wahrheit suchen lässt. Emma ist so ein Kind, ein Kind, wie melancholische, intellektuelle Erwachsene sich Kinder wünschen oder eigentlich alle Menschen, frei von Gemeinheit und Berechnung, gerecht. Das ist eine tröstliche Projektion, und dass sie uns Leser und Leserinnen berührt und über fast 500 Seiten zu fesseln vermag, zeigt, dass auch wir die Sehnsucht nach einer menschlichen Gattung kennen, die wirklich human ist. Die liebt, die vertraut, die treu ist und nicht verrät. Die Angst hat und die Angst überwindet.
Die Sprache, in der Dragomán schreibt – auch bei seinem zweiten ins Deutsche übersetzten Roman, »Der weiße König«, 2008 erschienen, war die Erzählerfigur ein Kind, der elfjährige Dzsátá –, ist ein atemloses Präsens hyperpräziser Beschreibungen. Wie das Haus geputzt, gekocht, das Silberbesteck gereinigt, Feuer gemacht, die Bettwäsche gebügelt wird, wie jemand die Treppe heraufkommt, einen Schlüssel ins Tor steckt, Schlittschuhe anzieht, das Motorrad zum Laufen oder Stehen bringt – alles wird wie unter der Lupe, fast schon dem Mikroskop betrachtet. Der Schulweg, die Raufereien, der Lehrer, der im Klassenbuch blättert, um den Namen des nächsten zu prüfenden Kindes auszuwählen, die Anspannung, die allen so lange den Nacken beugt. Es ist, als sollten die minutiös dokumentarischen Beschreibungen den ins Rutschen geratenen Verhältnissen, den zerrissenen Biografien Halt geben, es sind Beschwörungen, sprachmagische Rituale, die die Realität zusammenhalten – wenn eins aufs andere folgt, man alles genau beachtet, Schritt für Schritt, kann nichts daneben-, nichts verlorengehen, das Leben ist dann wie ein Kochrezept, man rührt die Zutaten zusammen, knetet, der Teig geht auf, fertig. Wenn man stolpert, muss man nur das Tempo verlangsamen, dann kommen Füße, Hände, Dinge wieder ins Lot. Und wenn man alles aufzählt, nichts weglässt, nichts vergisst, kommt die Wahrheit ans Licht.
Aber die Wahrheit, wenn es sie überhaupt gibt, ist zwischen den Menschen. Sie ist nie bei nur einem von ihnen. Nicht bei der Großmutter, nicht beim Vater, nicht beim Zeichenlehrer und nicht bei der Bibliothekarin. Und auch nicht bei Krisztina, die ihre Zwillingsschwester während der Demonstrationen im Kugelhagel der Heckenschützen verloren hat und jetzt Emmas Banknachbarin ist. Und auch nicht bei Péter, der sie liebt. Seltsam also, dass Dragomán den Roman allein aus der Perspektive von Emma erzählt, zwar durchwoben von den Stimmen der anderen, mal in direkter Rede, mal indirekt, aber nie blicken wir aus den Augen eines anderen auf die postkommunistische rumänische Welt, wir müssen Emma glauben, ihren Erinnerungen, ihren Beschreibungen, ihren Beschwörungen, ihren Träumen. Ihrer Wahrheit.
Magie und Hyperrealismus, das sind Dragománs zwei Zauberkisten, in die er greift, um die Geschichte eines Mädchens zu erzählen, das die Schwelle zum Erwachsenwerden überschreitet, das zum ersten Mal verliebt ist – und das allmählich begreift, in was für einem Land es aufgewachsen ist, wo und mit wem es lebt, dass es den Schmerz gibt und die Schuld und dass man mit beiden leben muss. Magie und Hyperrealismus sind aber auch ein literarischer Trick. Sie erzeugen eine Unschärfe zwischen dem, was nur für Emma real ist, tatsächlich aber nur in ihrer Vorstellung existiert, und dem, was draußen geschehen ist und geschieht, zwischen dem nackten Bericht der Geschehnisse und Emmas Imaginationen. Das ist nicht unbedingt Poesie, sondern ein schlichtes Spiel, das den Leser in ständiger Kippbewegung hält. Nicht, weil die Geschichte es verlangt, sondern weil Dragomán es so will. Und mit dem Erzählton ist es ähnlich – Dragománs Sprache peitscht einen über hundert, zweihundert Seiten durch einfache Syntax, parataktische Reihungen und Wiederholungen. Aber das beständige Crescendo mit den wenigen wiederkehrenden rhetorischen Figuren lässt zunehmend nur noch sich selbst hören, nicht mehr, was es erzählt. Ein wenig mehr Bescheidenheit, mehr Distanz zur Figur hätte dem Roman gut getan. Vielleicht wird der nächste einen noch reiferen Heranwachsenden zur Hauptfigur haben, der komplexer denkt und handelt. Und in einer raffinierteren, komplexeren Sprache erzählt.
György Dragomán: »Der Scheiterhaufen«. Roman. Aus dem Ungarischen von Lacy Kornitzer. Suhrkamp 2015, 495 Seiten, 24,95 Euro
fixpoetry, 3. November 2015