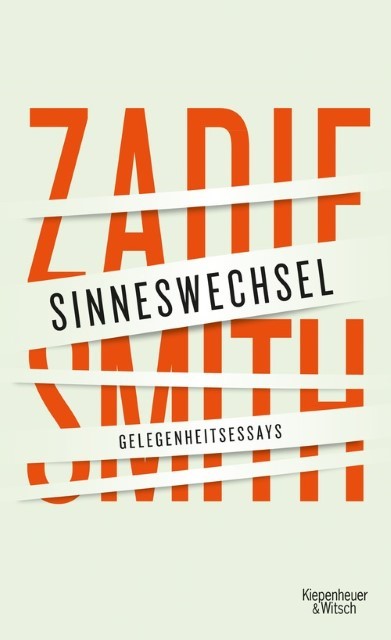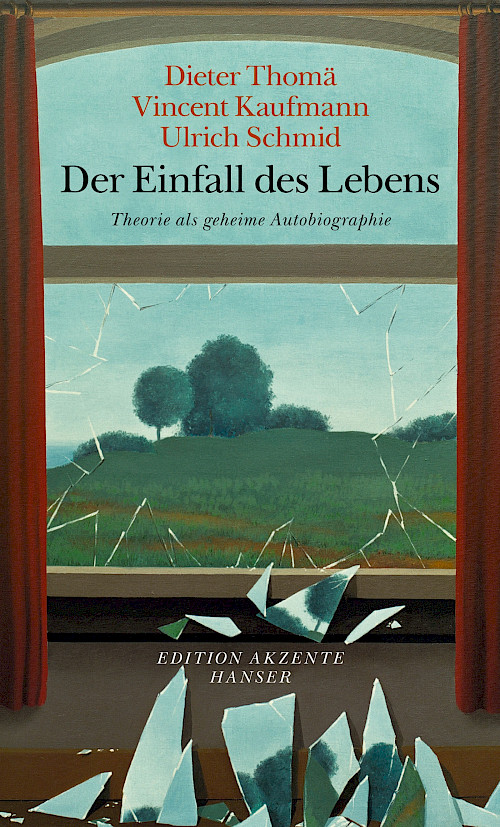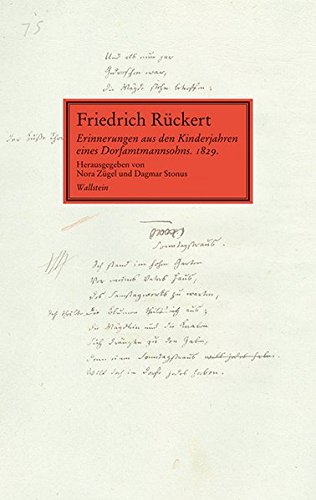Lesen, Sein, Sehen, Fühlen, Gedenken
Zadie Smith’, die mit ihrem Debüt »Zähne zeigen« zum internationalen Literaturstar wurde, legt jetzt einen Band mit »Gelegenheitsessays« vor
Die britische Autorin Zadie Smith, in jungen Jahren schon berühmt geworden mit ihrem Roman »White Teeth« (Zähne zeigen, 2000), dem zwei weitere, »On Beauty« (Von der Schönheit, 2005) und »NW« (London NW, 2012), folgten, arbeitet auch als Kritikerin und Essayistin, unter anderem für den »Guardian«, den »New Yorker«, die »New York Review of Books« und »Harper’s Magazine«. So ist, wie sie in ihrem kurzen Vorwort zu »Sinneswandel«, einem Band, in dem einige dieser Essays jetzt gesammelt erschienen sind, schreibt, »hinter ihrem Rücken« ein Buch entstanden, in dem Smith nicht als Romanautorin auftritt, sondern als Filmkritikerin, Literaturrezensentin, Reisereporterin und Memoirenschreiberin. Ein sehr schönes, ernstes, humorvolles, leichtes, unbedingt lesenwertes Buch.
Die »Gelegenheitsessays« beschäftigen sich mit Kafka und E. M. Forster, mit Barthes und Nabokov, sie erzählen von Smith’ Familie und wie sie Weihnachten feiert, sie lassen die alten Stars Hollywoods noch einmal funkeln, und der längste ist der Versuch, das Genie David Foster Wallace’ zu fassen, die Skrupel, die er beim Schreiben empfand, nachzuzeichnen, die Schwierigkeiten, die er den Lesern seiner Romane und Erzählungen bereitet. Wallace ist ein Autor, den Smith bewundert, obwohl er sie anstrengt, manchmal überfordert, und dem sie in diesem langen Text einen Nachruf schenkt – Wallace hatte, während sie an dem Essay schrieb, Selbstmord begangen –, indem sie einen seiner Erzählungsbände, »Kurze Interviews mit fiesen Männern«, wiederliest, das heißt studiert, analysiert, an Wallace’ Anspruch misst – und ihrem eigenen. Wallace ist für sie der Autor, der das Dilemma des ernsthaften fiktionalen Schreibens im Zeitalter der Hyperreflexion, der totalen Rationalisierung und des Materialismus kreuzt mit Moral und Gewissen. Und nach dem L-Wort fragt, der Liebe. Und ohne die oder wenigstens die Sehnsucht nach ihr geht es nicht. Nicht im Leben und nicht in der Literatur.
Zadie Smith schreibt – in guter englischer Tradition – ihre Essays von einem höchst subjektiven Standpunkt, einem Ich, das sich, im Laufe des Schreibens, aus der Ebene der alltäglichen Ansichten die Hügel hinauf bewegt, dann einen Berg erklimmt, um allmählich an Übersicht und Weitblick zu gewinnen. Sich auf diesem Weg aber immer wieder zur Erde niederbeugt, um etwas Winziges zu seinen Füßen zu betrachten, einen Käfer, einen Grashalm, einen Stein, das innehält, um zu riechen, zu tasten, zu lauschen. So ist Smith ihrem Thema, dem Autor, den sie porträtiert, dessen Eigenarten sie analysiert, nah und fern zugleich. Sie hält sich nicht zurück mit dem Eingeständnis, etwas nicht verstanden oder gemocht zu haben, oder, umgekehrt, von etwas fasziniert zu sein. Aber sie nimmt es genau unter die Lupe, sie dreht und wendet es, sie will wissen, warum. Sie sagt, was ihr Angst macht und was ihr nicht gefällt. Sie vergleicht. Sie ist eine Autorin aus Fleisch und Blut, mit klarem Verstand, belesen, philosophisch geschult, selbstkritisch. Und sie ist, wie Wallace, eine Moralistin.
Das ist ungewöhnlich. Aber auch etwas Britisches. Nicht nur zu fragen, wie etwas funktioniert, sondern auch, warum es funktioniert, wie es funktioniert, und ob das gut sei. Dabei predigt Smith nicht, sie gibt zu denken. Sie wechselt die Perspektiven, sie ist kritisch, auch mit sich selbst, die Essays sind immer auch Selbstvergewisserungen, Selbstbefragungen. Das Reden in Zungen und nicht als Dogmatikerin ist ihr wichtig. In Zeiten fließender Identitäten, in denen das »ich“ je nach Lebensalter und Kontext andere Konturen und anderen Ausdruck gewinnt, ist Vielstimmigkeit eine Kunst, ohne die das Schreiben keinen Wert hat. Die Wahrheit eines Schriftstellers, einer Schriftstellerin liegt in der Sprache. Sie muss wirklich empfunden, um sie muss gerungen worden sein. Das kostet Kraft, manchmal mehr, als man hat. Zweifel, Verzweiflung, Ekel, Scheitern sind unumgänglicher Teil des Schreibprozesses.
In einem der Texte beschäftigt sich Smith mit dem altbekannten britischen Thema des sozialen Aufstiegs über das Erlernen der »richtigen« Sprache, also die Überformung von Wortschatz, Artikulation und Färbung des eigenen Idioms durch ein anderes, die es erlaubt, von einer sozialen Schicht in eine andere, ranghöhere, zu wechseln (wie es George Bernard Shaw in »Pygmalion« dargestellt hat) – was von den Aufstiegswilligen natürlich permanente Mimikry erfordert und für die Aufgestiegenen eine Identitätskrise zur Folge hat, fühlen sie sich doch schließlich abgeschnitten von ihrer Herkunft. Smith kennt das – als Tochter einer schwarzen Jamaikanerin und eines weißen Engländers, aufgewachsen in einem Arbeiterviertel im Londoner Nordwesten, die am Cambridger King’s College englische Literatur studiert, geht sie genau den Weg, den auch Shaws Blumenmädchen geht. Und verliert ihre alte Stimme. Aber dann pariert sie den Verlust mit einer neuen Erfahrung – dass das Dazwischen, an dem Shaws Figur leidet und scheitert, der neue Ort, das neue Zuhause ist: Dream City nennt sie diese Welt der vielen Stimmen, der sich überlappenden Identitäten, der komplizierten Herkunfts- und Sozialisierungsgeschichten, der Beweglichkeit, der humorvollen Distanzierung. Es ist ihr Ort, die Welt der Literatur.
Zadie Smith: »Sinneswechsel«. Gelegenheitsessays. Aus dem Englischen von Tanja Handels. Kiepenheuer & Witsch 2015, 473 Seiten, 34 Euro
fixpoetry, 13. Oktober 2015